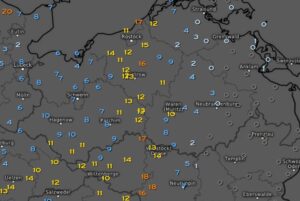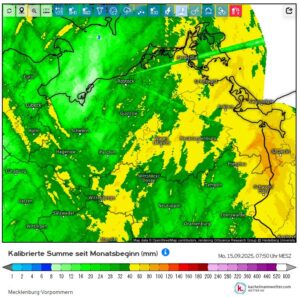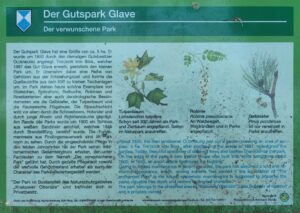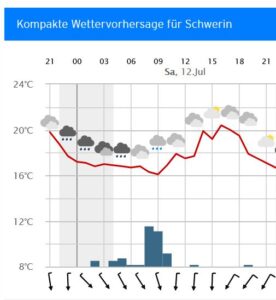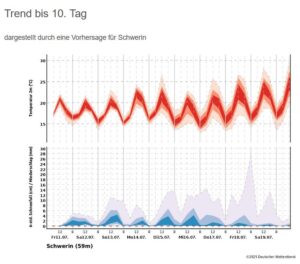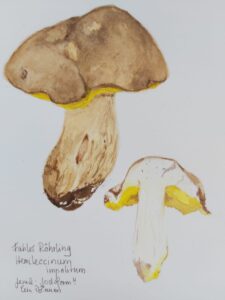10.09.2025 – MTB 2135/4 bei Trams
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Zurow
10. September 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2135/4 – bei Trams
An einem milden Septembernachmittag trafen sich Anne, Maria, Christian, Julia und Katarina mit ihrer Hündin Berta am Waldrand in Trams zwischen dem Pröbberower und dem Tramser See.
Es stand der letzte Quadrant unserer Kartierung im MTB Zurow auf dem Plan.
Der Weg führte zwischen Kiefern auf sandigem Boden in den Wald und in Richtung des alten Herrenhauses. Wir haben uns zunächst an den Pfad gehalten, da der Wald durch dichte Brombeersträucher und Gestrüpp nur schwer begehbar war. Unsern Blick richteten wir dabei immer wieder auf die Stammfüße der Kiefern, in der Hoffnung, eine Krause Glucke zu entdecken.
Mit der goldenen Stunde und dem Untergang der Sonne neigte sich der Abend langsam dem Ende zu. Die ca. 20 verschiedenen Arten, die wir gemeinsam finden und bestimmen konnten, war weniger als erhofft. Trotzdem hatten wir einen schönen gemeinsamen Nachmittag und jeder hat auch wieder etwas Neues dazugelernt. Wir freuen uns auf den Regen der kommenden Tage und auf die nächste gemeinsame Exkursion.
Julia (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich zu Beginn unserer Exkursion beiendruckte uns ein schöner solitär stehender Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) auf einer freien Fläche.
Foto: Christian Boss

Gleich dahinter befand sich die Ruine des alten Herrenhauses. Bis 1996 diente es als Internat, danach kurzzeitig bis 1997 als Förderschule. Im August 2001 brannte das Herrenhaus, das sich in Privatbesitz befindet, zum großen Teil nieder und ist jetzt dem Verfall preisgegeben.
Foto: Julia Richardt

Weiter ging es in Richtung eines jungen Lärchenbestandes. Im Unterholz zeigten sich mehrer Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum).
Foto: Julia Richardt

Kurz darauf jubelten Anne und Christian fast zur selben Zeit, da sie Beide auf die ersten größeren Pilze des Tages gestoßen sind. Es handelte sich um Parasole (Macrolepiota procera) verschiedenen Alters am Wegrand.
Foto: Christian Boss

Die jungen Pilze mit dem noch geschlossenen Hut werden wegen ihrer Form auch Paukenschlägel genannt.
Foto: Christian Boss

Brombeeren. Auf den Blättern sehen wir auch einen Pilz – den häufig vorkommenden Brombeerrost (Phragmidium violaceum).
Foto: Julia Richardt

Dazu passt natürlich auch die Raupe des Brombeerspinners (Macrothylacia rubi) – ein Nachtfalter aus der Familie der Glucken (Lasiocampidae).
Foto: Christian Boss

Ein Schwarzhörniger Totengräber (Nicrophorus vespilloides) fungiert hier als Taxi-Unternehmen für Milben, die sich von dem Käfer von einem Fressplatz zum nächsten tragen lassen.
Foto: Christian Boss

Nachdem wir ein wenig umhergeirrt sind, entdeckten wir einen Weg, der uns direkt zwischen einem weiteren Kahlschlag und einem Kiefernwald zum Pröbberower See führte.
Foto: Julia Richardt

Am See erwartete uns neben den vielen Mücken und Spinnen auch ein alter Riesenporling (Meripilus giganteus) an einer großen Rotbuche.
Foto: Christian Boss

Wir sind einem kleinen Pfad entlang des Sees bis an den Waldrand gefolgt, wo eine große Wiese und alte Eichen auf uns warteten.
Foto: Julia Richardt

Danach folgten Hängebirken, die als erste Baumart die Fläche nach einem Kahlschlag erobern
Foto: Julia Richardt

Der Starkblauende Rotfußröhrling ist eine erst seit wenigen Jahren als eigenständig erkannte Art aus dem schwierigen Komplex der Rotfußröhrlinge.
Foto: Julia Richardt

Ein altes von der Trockenheit gezeichnetes Exemplar des Brennenden Rüblings (Gymnopus peronatus).
Foto: Christian Boss

Der Flockige Trompetenschnitzling (Tubaria conspersa) ist nach dem Gemeinen Trompetenschnitzling die zweithäufigste Art dieser Gattung in Mitteleuropa. Beide kommen ganzjährig vor und beide wachsen saprobiontisch auf totem Holz, meistens an dünneren Ästchen, aber auch am Boden an vergrabenem Holz oder Pflanzenresten.
Foto: Christian Boss

Rosablättriger Helmling (Mycena galericulata). Es ist eine der häufigsten Pilzarten, die fast ganzjährig gesellig an Holz, besonders an alten Stubben, anzutreffen sind. Ein Merkmal sind die anastomosierenden Lamellen – also adrige Querverbindungen zwischen den Lamellen.
Foto: Christian Boss

Der giftige Grünblättrige Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare) hat uns den ganzen Tag lang begleitet, sowohl junge Exemplare…
Foto: Julia Richardt

Schon bald darauf befanden wir uns wieder zurück am Start unserer heutigen Exkursion. Da die Zeit allerdings noch nicht weit fortgeschritten und auch die Motivation der Gruppe nicht erloschen war, suchten wir uns noch einen weiteren Weg. Dieser führte uns entlang eines neugebauten Spielplatzes und verschiedenen Obstgehölzen zum Tramser See.
Foto: Julia Richardt

Auf dem mit Gras bewachsenem Pfad wurden wir dann noch einmal mit einigen neuen Funden belohnt…
Foto: Julia Richardt

Einer der Düngerlinge (Panaeolus sp.). Diese Gattung ist mikroskopierpflichtig, um die Pilze auf Artebene zu bestimmen.
Foto: Maria Schramm

Das Sporenpulver der Düngerlinge ist schwarz, die Lamellen sind im reifen Zustand dunkelbraun bis schwarz, aber durch den unterschiedlichen Zeitpunkt der Sporenreife gescheckt.
Foto: Maria Schramm

Christian hatte wohl immer noch nicht genug und holte auf einmal sein Fernglas aus dem Rucksack. Ob er damit am anderen Ufer eine interessante Entdeckung machen konnte? Er hat es uns nicht verraten…
Foto: Julia Richardt

Das Erinnerungsfoto von der heutigen Kartierungsexkursion bei Trams.
V.l.n.r.: Maria, Christian, Julia und Katarina sowie Berta
Foto: Annett Krause
Die Artenliste bei Trams im MTB 2135/4:
Gesäter Tintling (Coprinellus disseminatus), Gemeiner Glimmertintling agg. (Coprinellus micaceus agg.), Weißer Adernnabeling (Delicatula integrella), Waldfreundrübling agg. (Gymnopus dryophilus agg.), Brennender Rübling (Gymnopus peronatus), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Erdblättriger Risspilz (Inocybe geophylla), Rötlicher Lacktrichterling (Laccaria laccata), Flaschenstäubling (Lycoperdon perlatum), Gemeiner Riesenschirmling (Macrolepiota procera), Riesenporling (Meripilus giganteus), Rosablättriger Helmling (Mycena galericulata), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Ahorn-Runzelschorf (Rhytisma accerinum), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Goldröhrling (Suillus grevillei), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Flockiger Trompetenschnitzling (Tubaria conspersa), Starkblauender Rotfußröhrling (Xerocomellus cisalpinus)
Pilze und Wetter September 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im September 2025

Krause Glucken (Sparassis crispa) haben jetzt Hochsaison. Sie können auch in trockeneren Gebieten gefunden werden.
01.09.2025 – Montag
Ich beginne mal mit den letzten Worten von Hanjo aus dem Tagebuch August 2025:
„Der Mykophage in mir weiß nun aber – die nächsten Besuche werden nicht den Buchenwäldern gelten, sondern in den umliegenden Kiefernwäldern stattfinden. Denn Krause Glucken sind ebenfalls Holzbewohner, auch wenn sie meist neben den Wirtsbäumen aus dem Boden zu kommen scheinen. Sie sind nun das Objekt der Begierde und die Zeit ist ran, um nach ihnen zu suchen. Sollte sich Erfolg einstellen, wird hier sicher davon zu lesen sein.“
Und bereits einen Tag später – also am Sonntag – kam die Erfolgsmeldung von Hanjo aus den trockenen Kiefernwäldern.
Catrin und Hanjo

Da war sie – die erste Krause Glucke (Sparassis crispa)! Ganz frisch und knackig und ein betörend würziger Duft.
Foto: Hanjo Herbort

Egal – ab ins Körbchen damit. Wozu hat man eine Frau zu Hause – das wird lecker!
4 km Strecke für 2 Glucken – die Mahlzeit ist mehr als verdient!
Foto: Hanjo Herbort
07.09.2025 – Sonntag
Am Donnerstag und Freitag gab es endlich mal in einigen Teilen Mecklenburgs etwas Regen. Allerdings reichen diese Niederschlagsmengen noch nicht, um das Pilzwachstum so richtig in Gang zu bringen.
In den Laubwäldern herrscht immer noch Flaute. Bis auf ein paar Baumbewohner ist dort nur vereinzelt etwas zu finden.
Etwas besser sieht es derzeit in den Nadelwäldern aus. Nicht nur Krause Glucken gibt es derzeit in den Kiefernwäldern.
Marco war am Wochenende in der Müritz-Region nicht ganz erfolglos unterwegs – es hat zumindest für eine Pilzmahlzeit gereicht.
Hier eine kleine Auswahl der von Marco gefundenen Pilze.
Catrin

Butterpilze oder Butter-Röhrlinge (Suillus luteus) sind Mykorrhiza-Pilze der Kiefer und auch nur dort zu finden.
Foto: Marco Hellmuth-Meija

Der Kupferrote Gelbfuß (Chroogomphus rutilus) gehört wie der Butterpilz ebenfalls zu den Schmierröhrlingsverwandten und ist auch nur unter Kiefern zu finden.
Foto: Marco Hellmuth-Meija

Echte Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) sind ebenfalls Mykorrhizapilze, die mit diversen Nadel- und Laubbäumen Symbiosen eingehen. In Mitteleuropa ist der bevorzugte Baumpartner die Gemeine Fichte, gefolgt von der Rotbuche. Außerdem kann der Pilz mit Eichen, Kiefern und Tannen vergesellschaftet sein.
Foto: Marco Hellmuth-Meija
14.09.2025 – Sonntag
Die letzten Tage hat es bei uns in Mecklenburg-Vorpommern fast täglich mehr oder weniger geregnet. Zeit, sich mal die Niederschlagssummen seit Anfang des Monats anzusehen, um damit eine Prognose für das mögliche Pilzwachstum abzugeben.
Wie wir der Grafik entnehmen können, haben die Regionen um Waren-Müritz bis nach Vorpommern mit über 40 l in den letzten 2 Wochen die meisten Niederschläge abbekommen. Nordwestmecklenburg, Schwerin und die Landkreise Parchim-Ludwigslust und Rostock wurden dagegen nur mit 10 bis 30 l bedacht.
Trotzdem sollte in ca. 1 Woche zumindest in den regenreicheren Regionen die Artenvielfalt an Pilzen so langsam zunehmen.
Corina war am Wochenende in Nadelwäldern in der Nähe von Waren-Müritz unterwegs – hier einige ihrer Funde.
Corina und Catrin

Sie sind wieder da! Edel-Reizker oder Echte Reizker (Lactarius deliciosus). Der Pilz lebt mit Kiefern in Symbiose und wird deshalb und wegen seiner orangenen Milch auch Kiefern-Blutreizker genannt.
Foto: Corina Peronne

Der Hutrand ist oft wellig verbogen. Auf einem ocker-orangefarbenen bis ziegelroten Grund befindet sich eine ausgeprägte dunklere Zonierung oder ein konzentrisch getropftes Muster. Der Stiel hat fast die gleiche Farbe wie der Hut und zeigt meist deutlich abgesetzte, dunklere Gruben.
Foto: Corina Peronne

Ebenfalls ein strenger Kiefernbegleiter ist der Kupferrote Gelbfuß (Chroogomhus rutilus). Im jungen Zustand sind die Lamellen von einem flockig-zartfaserigen Velum bedeckt.
Foto: Corina Peronne

Ebenfalls im Nadelwald finden wir den Fuchsigen Rötelritterling bzw. -trichterling (Paralepista flaccida). Der Pilz ist sehr gesellig und wächst gerne in Reihen oder Hexenringen.
Foto: Corina Peronne

Der Langstielige Anis-Dufttrichterling (Clitocybe fragrans) riecht – wie der Name schon sagt – deutlich nach Anis. Die ziemlich gedrängt stehenden Lamellen sind breit am Stiel angewachsen oder laufen etwas daran herab, sie sind blass beige bis cremefarben gefärbt.
Foto: Corina Peronne
15.09.2025 – Montag

Ein Mykorrhiza-Pilz (Symbiosepilz) mit der Lärche ist der Goldröhrling bzw. Goldgelber Lärchenröhrling (Suillus grevillei).
Foto: Corina Peronne
Ich möchte euch hier weitere Funde von Corina vom Wochenende zeigen und vorstellen.
Hier einmal kurz und einfach die Symbiose zwischen Bäumen und Pilzen (Mykorrhiza) am Beispiel des Lärchenröhrlings erklärt.
Über ihr Feinwurzelwerk versorgt der Lärchenröhrling die Lärche mit Phosphor und erhält von der Lärche dafür wiederum wertvolle organische Nährstoffe, die bei der Photosynthese entstehen. Der Lärchenröhrling ist auf Unterstützung der Lärche angewiesen, da Mykorrhiza-Pilzen ein lebensnotwendiges Enzym fehlt. Dieses stellt ihm der Baum zur Verfügung. Umgekehrt können die Pilze Salze, Wasser und Mineralstoffe besser aus der Erde lösen als Baumwurzeln, womit der Röhrling also die Lärche versorgt.
Es gibt nicht nur den allseits bekannten Goldgelben Lärchenröhrling, sondern auch den selteneren Grauen Lärchenröhrling (Suillus viscidus) sowie den Rostroten Lärchenröhrling (Suillus tridentinus) und einige Varietäten.
Catrin

Seltener findet man den Grauen Lärchenröhrling (Suillus viscidus) – wie der Name schon verrät – ebenfalls unter Lärchen.
Foto: Corina Peronne

Hier im direkten Vergleich:
Goldgelber Lärchenröhrling (Suillus grevillei) + Grauer Lärchenröhrling (Suillus viscidus).
Foto: Corina Peronne
16.09.2025 – Dienstag

Der Blaustiel-Schleimfuß (Cortinarius collinitus) ist ein Mykorrhizapilz der Fichte. Er hat einen sehr schleimigen, gelb- bis rostbraun gefärbten Hut und jung einen ebenso schleimigen violett-bläulichen Stiel.
Foto: Corina Peronne
Die Artenvielfalt nimmt allmählich zu und es wird langsam bunter im Wald – es zeigen sich mittlerweile Pilze aus den verschiedensten Gattungen.
Auch an den farbenfrohen Schleierlingen (Cortinarius) können wir uns erfreuen. Es handelt sich hierbei um eine sehr artenreiche Gattung, die aktuell in 11 Gattungen aufgetrennt wurde. Da die Bestimmung – gerade für Laien – in dieser artenreichen Gattung meist sehr schwierig ist, können Schleierlinge generell nicht zum Verzehr empfohlen werden.
Der wissenschaftliche Name Cortinarius leitet sich ab von lateinisch Cortina, was übersetzt „Schleier“ heißt. Bei letzterem handelt es sich um ein sehr feines, aus spinnwebartigen Fasern gebildetes Velum zwischen Hutrand und Stiel, weshalb die Gattung auch Haarschleierlinge genannt wird. Die Cortina ist ein charakteristisches Merkmal, kommt aber auch bei einigen anderen Gattungen vor.
Aber auch Pilze aus anderen Gattungen können sehr farbenfroh daher kommen. Hier noch einige schöne Funde von Corina vom letzten Wochenende.
Catrin

Hier kann man deutlich das aus spinnwebartigen Fasern gebildetes Velum zwischen Hutrand und Stiel erkennen.
Foto: Corina Peronne

Auch Champignons müssen nicht immer weiß sein… Hier ein nicht näher bestimmter farbenfroher Vertreter aus der Sektion Arvensis. Das sind Anis-Egerlinge (in der Regel nach Anis riechende Arten).
Foto: Corina Peronne
17.09.2025 – Mittwoch

Die Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus) ist ein saprobiontischer Bewohner humusreicher Böden oder wächst in der Nähe von morschem Holz.
Foto: Angeli Jänichen
Der Regen kam gerade noch rechtzeitig… Ende September finden bei uns in Mecklenburg-Vorpommern die meisten Pilzausstellungen statt. Auch unser Herbstseminar Anfang Oktober in Waren-Müritz. Siehe auch unter Termine 2025.
So ist gewährleistet, dass sowohl bei den Ausstellungen als auch bei unserem Seminar viele Pilze gezeigt werden können. Übrigens sind gerade bei unserem seit langer Zeit ausgebuchten Herbstseminar wieder 2 Plätze frei geworden. Also – wer vom 03.10. bis 05.10.2025 Zeit und Lust hat – meldet euch noch schnell an!
Auch Angeli hat es nach ihrem Urlaub geschafft und ihren Lieblings-Moorwald besucht. Neben Stinkmorcheln und Bluthelmlingen auch ein weiterer „blutiger“ Pilz – der Eichen-Leberreischling. Ein Erstfund für Angeli, über den sie sich sehr gefreut hat.
Catrin

Hier sehen wir das Anfangsstadium der Gemeinen Stinkmorchel – eine als Hexenei bezeichnete kugelige bis breit eiförmige Knolle.
Foto: Angeli Jänichen

Die Unterseite des Leber-Reischlings weist bei keine einzeln stehenden Röhrchen auf, sondern miteinander verwachsene Röhren.
Foto: Angeli Jänichen

Großer Bluthelmling (Mycena haematopus). Die Huthaut ist matt und fleisch- oder purpurbräunlich. Der Rand ist durchscheinend gerieft, mit etwas überstehender, gezähnelt-gefranster Huthaut. Der Stiel ist schwach bepudert oder bereift und rosabräunlich oder wie der Hut gefärbt. Der Pilz scheidet bei Verletzung einen rötlichen Saft aus.
Foto: Angeli Jänichen
19.09.2025 – Freitag

Butterpilz oder Butter-Röhrling (Suillus luteus) + Körnchen-Röhrling oder Schmerling (Suillus granulatus)
Foto: Hanjo Herbort
In einigen Gegenden hat das Pilzwachstum bereits richtig begonnen – vor allem in den Gebieten westlich von Waren (Müritz). Jedoch noch nicht in den den besseren Buchenwäldern in Nordwestmecklenburg und dem westlichen Landkreis Güstrow…
Da das Pilzwachstum hier immer noch nicht so richtig in Gang gekommen ist, war Hanjo gestern in einem aufgeforsteten kalkhaltigem Kiefern- und Fichtenforst mal kurz nachsehen. Das Gebiet soll Ziel einer internenen Vereinswanderung nächste Woche Mittwoch werden und er wollte mal kurz nachsehen, ob es sich lohnt, dort hinzufahren.
Dort angekommen fand er ein so nicht erwartetes Frischpilzaufkommen vor – sowohl für den „Kochtopfmykologen“ als auch für den mykologisch ein wenig mehr interessierten Pilzfreund.
Ein paar Funde möchten wir euch bereits heute zeigen – für unsere Vereinsexkursion folgt nächste Wochen ein gesonderter Beitrag.
Catrin

Wie aufgereiht standen die Großen Schmierlinge – auch als Kuhmaul (Gomphidius glutinosus) bekannt.
Foto: Hanjo Herbort

Aufgrund seiner schmierigen Huthaut hat der Große Schmierling zahlreiche Trivialnamen erhalten – zu den bekanntesten zählt die Bezeichnung Kuhmaul. Ein weiterer Name ist Gelbfuß, der durch seine auch innen gelbe Stielbasis entstand.
Foto: Hanjo Herbort

Ein weiterer Pilz mit einem gelben Fuß ist Kupferrote Gelbfuß (Chroogomphus rutilus).
Foto: Hanjo Herbort
21.09.2025 – Sonntag

Auch der Sandröhrling (Suillus variegatus) ist eine Pilzart aus der Familie der Schmierröhrlingsverwandten (Suillaceae), obwohl die Hutoberfläche filzig-matt ist. Sie wird erst bei längerem Regen schmierig.
Foto: Corina Peronne
Corina war am Wochenende wieder in der Warener Gegend unterwegs und hatte ebenfalls in den sandigen Kiefernwäldern einige schöne Funde.
Darunter auch als Erstfund den Reifpilz (Cortinarius caperatus). Es handelt sich hierbei um einen der wenigen Speisepilze aus der Familie der Schleierlingsverwandten (Cortinariaceae).
Charakteristich ist unter anderem der längsrunzelige Hut der Fruchtkörper. Letzteres Merkmal brachte dem Pilz auch die Namen Runzelschüppling und Scheidenrunzling ein. Auch der zweite Teil des wissenschaftlichen Artnamens caperatus bezieht sich darauf und leitet sich von lateinisch caperatus „gerunzelt“ ab.
Ein weiteres wichtiges Merkmal ist ein deutlicher und dauerhafter und häutiger Ring, der sich im oberen Drittel des Stiels befindet. Die Manschette liegt am Stiel an, ist oberseitig fein gerieft und hat einen doppelten Rand.
Catrin

Der Sand-Röhrling hat seinen deutschen Namen von der sandig wirkenden Hutoberfläche.
Foto: Corina Peronne

Reifpilz (Cortinarius caperatus). Hier sehen wir sehr schön den doppelten Ring und den längsrunzeligen Hut.
Foto: Corina Peronne

Charakteristisch ist der strohgelbe bis gelbbraune Hut mit einer grauen bis weißlichen und schwach lila getönten Bereifung.
Foto: Corina Peronne

Der giftige Spitzschuppige oder Raue Stachel-Schirmling (Lepiota aspera) kommt recht häufig in Laub- und Nadelwäldern, an Wegrändern und in Gärten vor.
Foto: Corina Peronne
23.09.2025 – Dienstag
Heute war Corina mal direkt in Waren-Müritz unterwegs. Dieses mal hat sie ausgekundschaftet, wie das Pilzwachstum dort ist. Schließlich findet dort nächstes Wochenende unser 3-tägiges Herbstseminar statt. Und es sieht dort sehr gut aus, was die Artenvielfalt betrifft.
Auch die vielen Pilzausstellungen, die dieses Wochenende in Mecklenburg-Vorpommern statt finden, werden sicherlich von dem Pilzwachstum profitieren. Pilzausstellungen finden z.B. hier statt:
Rostock, Botanischer Garten, Holbeinplatz/Hamburger Straße 28
27.09.2025 bis 28.09.2025 täglich 10.00 bis 18.00 Uhr
Greifswald, Botanischer Garten, Münterstr. 2
27.09.2025 bis 28.09.2025 täglich 10.00 bis 17.00 Uhr
Neubrandenburg, Marktplatz
27.09.2025 von 10.00 bis 17.00 Uhr
Schwerin, Am Strand 9
27.09.2025 von 14.00 bis 18.00 Uhr und 28.09.2025 von 10.00 bis 16.00 Uhr
Nachfolgend ein paar Impressionen von Corinas heutigen Funden.
Catrin

Einen angenehm würzigen Geruch hat der Würzige Tellerling (Rhodocybe gemina). Die fleischrosa Sporenpulverfarbe verweist in die Familie der Rötlingsverwandten.
Foto: Corina Peronne

Eine Familie frisch „geschlüpfter“ Buckel-Täublinge (Russula caerulea) auf dem Waldweg bei Kiefern.
Foto: Corina Peronne

Der namensgebende deutlich gebuckelte Hut ist hier sehr gut auf dem dunkelvioletten bis purpurbraunen Hut zu sehen.
Foto: Corina Peronne

Der Olivbraune Milchling (Lactarius turpis) ist mit seinen düsteren Farben, den graubraun fleckenden Lamellen und seiner feucht klebrig-schleimigen Huthaut wahrlich nicht schön – turpis heißt häßlich. Früher war der wissenschaftliche Name Lactarius necator – necator ist lateinisch und heißt Mörder. Auch im deutschen Sprachgebrauch wurde er früher als “Mordschwamm” verteufelt, obwohl er noch nie Jemanden umgebracht hat. Er soll Magen-/Darmbeschwerden verursachen und steht im Verdacht, karzinogene und mutagene Inhaltsstoffe zu haben.
Foto: Corina Peronne

Junger Pantherpilz (Amanita pantherina) mit seinem braunen Hut, weißen Flocken auf dem Hut und serpentinenartig von unten, der Basis beginnendem, ringförmigem weißem Ring-Gebilden (Bergsteigersöckchen).
Foto: Corina Peronne

Der Fliegenpilz (Amanita muscaria) hat ebenfalss eine Knolle – allerdings mit warziger Basis und weißen gürtelförmigen Velumzonen.
Foto: Corina Peronne
24.09.2025 – Mittwoch
Da es aufgrund der lang anhaltenden Trockenheit im Nordwesten Mecklenburgs kaum Pilze gibt, haben wir erst einmal keine weiteren Wanderungen und Kartierungsexkursionen in den Terminen veröffentlicht.
Einige Vereinsmitglieder wollten sich aber trotzdem am Mittwoch treffen, so dass wir kurzfristig eine Vereinsexkursion durchgeführt haben. Dazu bot sich das von Hanjo bereits die Woche dafür besuchte Gebiet bei Perniek an – in den Kiefernwäldern gab es ja wie bei Corina in der Warener Gegend doch einige Pilze zu finden.
Also fanden sich 10 Vereinsmitglieder aus der Nähe von Lübeck, Ratzeburg, Wismar, Schwerin, Rostock, Renzow, Bützow, Waren und sogar Stralsund um 16 Uhr am verabredeten Treffpunkt bei Perniek zu ein.
Und wir wurden nicht enttäuscht – wir konnten einige schöne Funde verzeichnen und in unsere Kartierungsdatei aufnehmen.
Den genauen Bericht findet ihr demnächst hier.

Die meisten der Teilnehmer haben heute das erste mal Trüffel gesehen. Hier die Rötliche Wurzeltrüffel (Rhizopogon roseolus) – ein Symbiosepilz der Kiefer auf kalkreichem Boden.
Foto: Catrin Berseck
25.09.2025 – Donnerstag

Der Schiefknollige Anis-Champignon oder -Egerling (Agaricus essettei) riecht – wie der Name schon verrät – nach Anis.
Foto: Angeli Jänichen
Da unser neues Vereinsmitglied Ivy aus der Nähe von Stralsund gestern eine sehr weite Anreise hatte, haben sich 2 Vereinsmitglieder vor der gestrigen Vereinsexkursion bereits mittags mit ihr getroffen und vor der Vereinsexkursion in Perniek noch ein mooriges Gebiet bei Schlemmin aufgesucht.
Wie erwartet war das Pilzwachstum hier noch sehr verhalten. Lediglich die Gelben Knollenblätterpilze und Grünblättrigen Schwefelköpfe zeigten sich in Massen.
Trotzdem konnten wir ein paar schöne Funde machen – vor allem im Moorbereich.
Da wir in Wismar ja derzeit keine Pilzausstellung mehr machen, unterstützen wir die am Wochenende anstehende 47. Landespilzausstellung in Rostock. Es kam am Mittwoch auch Einiges an Ausstellungsexponaten zusammen – hier einige Pilzarten aus der Nähe von Schlemmin, die ebenfalls auf der Ausstellung in Rostock zu sehen sein werden.

Sein Fenchelduft – von manchen auch als anisartig wahrgenommen – verrät den den Fenchelporling bzw. Fencheltramete (Osmoporus odoratus).
Foto: Angeli Jänichen

Sie trotzen der Trockenheit – die Grünblättrigen Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare).
Foto: Angelis Jänichen

Olivblättrige Torfmooshautkopf (Cortinarius huronensis). Die Hautköpfe (Dermocybe) stellen eine Untergattung der Gattung Schleierlinge (Cortinarius) dar. Wichtigste Merkmale sind extrahierbare Anthrachinon-Pigmente, die diesen Pilzen kräftige Farben verleihen und die teilweise zum Färben von Textilien geeignet sind.
Foto: Angeli Jänichen

An feuchten und schattigen Stellen auf kalkreichem Boden ist bei genauem Hinsehen die Sattelförmige Lorchel (Helvella ephippium) zu finden.
Foto: Julia Richardt
27.09.2025 – Sonnabend
Wie jedes Jahr finden am letzten Wochenende im September viele Pilzausstellungen in Mecklenburg-Vorpommern statt.
Alljährlicher Höhepunkt der Pilzsaison ist auch in Rostock die größte Freilandschau von Frischpilzen, die der Botanische Garten in Rostock seit 1978 in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Hansestadt Rostock, dem Landesamt für Gesundheit und Soziales (LAGuS) Mecklenburg-Vorpommern und dem Freundeskreis Botanischer Garten Rostock ausrichtet.
Auch wir Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar haben im Vorfeld Pilze für die Ausstellung gesammelt und waren mit einigen Vereinsmitgliedern zum Helfen vor Ort.
27.08.2025 MTB 2135/3 bei Schimm
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Zurow
27. August 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2135/3 – bei Schimm
Sechs Pilzfreunde trafen sich heute in Schimm in Höhe der Bushaltestelle zu unserer Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Zurow.
Ein von Sträuchern und Bäumen gesäumter Weg, der entlang einer Wiese führte, brachte uns in den von Buchen dominierten Wald.
Ein Fund-Höhepunkt waren die Strubbelkopfröhrlinge. Frisches Wachstum gab es bei den Gelben Knollenblätterpilzen und den Spindeligen Rüblingen. Unbeeindruckt von der Trockenheit wuchs auch der Grünblättrige Schwefelkopf, auch der Violettstielige Pfirsichtäubling ließ sich finden.
Wie immer erfreuten uns neben den Pilzen auch andere Geschöpfe: die Raupe eine Mittleren Weinschwärmers, eine Ringelnatter schlängelte sich über den Weg und ein Grasfrosch saß geduldig Modell.
Der anhaltenden Trockenheit war es geschuldet, dass die Zahl der Funde überschaubar war – aber alle waren sich einig: eine sehr schöne entspannte Tour.
Sylvina (Text und Artenliste), Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung)

Die Raupe des Mittleren Weinschwärmers (Deilephila elpenor) hat auf jeder Seite zwei deutlich hervortretende Augenflecken, welche das Tier bedrohlich erscheinen lassen. Bei Beunruhigung ahmt die Raupe die Bewegungen einer Schlange nach, indem sie ihr Vorderteil mit den Augenflecken nach links und rechts wendet.
Foto: Angeli Jänichen

Und so sieht der Mittlere Weinschwärmer (Deilephila elpenor) dann später als voll ausgebildetes Insekt aus.
Foto: Christopher Engelhardt

Riesen-Champignon (Agaricus augustus) am Wegrand neben der Wiese. Sowohl der Hut als auch der Stiel sind mit kleinen abstehenden und bräunlich gefärbten Schüppchen besetzt.
Foto: Catrin Berseck

Trotz des leicht gerieften Hutrandes sehen wir hier einen trockenen Perlpilz (Amanita rubescens) mit vom Regen abgewaschenen Flocken.
Foto: Angeli Jänichen

Christian und Julia haben etwas entdeckt – Sylvina muss heute vertretungsweise die Kartierungsliste führen.
Foto: Angeli Jänichen

Gelbe Knollenblätterpilze (Amanita citrina) haben einen hell gelbgrünlichen bis weißlichen Hut, auf dem sich meist dicke, schollige, cremeweißliche bis bräunliche Hüllreste befinden.
Foto: Catrin Berseck

Der Stiel des Gelben Knollenblätterpilzes (Amanita citrina) hat eine deutlich knollige Basis, die in einer topfartigen, fest angewachsenen und kantig vom übrigen Stiel abgesetzten Volva steckt.
Foto: Angeli Jänichen

Grünblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare) sind saprophyte Pilze und ernähren sich von Totholz.
Foto: Angeli Jänichen

Der Striegelige Schichtpilz (Stereum hirsutum) besiedelt relativ frisches Totholz von Laubbäumen und überzieht es mit dünnen, flächig-ausgebreiteten und an den Rändern muschelförmig bis wellig abstehenden Fruchtkörpern. Im Inneren des Substrats erzeugt der Pilz durch den Abbau von Zellulose, Hemizellulose und des Holzstoffs Lignin eine Weißfäule.
Foto: Angeli Jänichen

Gemeiner Saltblättling (Schizophyllum commune). Der Aufbau erklärt auch die namensgebenden gespaltenen „Lamellen“, die bei Trockenheit auseinanderklaffen.
Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Rückweg.
Foto: Angeli Jänichen
Die Artenliste im Wald bei Schimm im MTB 2135/341 SW:
Riesen-Champignon (Agaricus augustus), Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina), Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), Perlpilz (Amanita rubescens), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Spindeliger Rübling (Gymnoporus fusipes), Grubiger Wurzelrübling (Hymenopellis radicata), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Gemeines Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis), Halsbandschwindling (Marasmius rotula), Flockenstielieger Hexenröhrling (Neoboletus erythropus), Hexenei der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus), Birkenporling (Piptoporus betulinus), Frauentäubling (Russula cyanoxantha), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Harter Zinnober-Täubling (Russula rosea), Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Strubbelkopf-Röhrling (Strobilomyces strobilaceus), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Gallenröhrling (Tylopilus felleus)
13.08.2025 – MTB 2135/2 Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Zurow
13. August 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2135/2 – Zurow

Blick in unser heutiges Exkursionsgebiet – das Sophienholz zwischen Nevern und Ravensruh.
Foto: Julia Richardt
Heute trafen sich 5 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. sowie 1 Gast bei hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad in Zurow auf dem Parkplatz. Der 2. Quadrant unseres Kartierungsgebietes im Messtischblatt 2135 stand auf dem Plan.
Uns stand unter anderem ein Waldstück nördlich von Zurow zur Verfügung, welches durch die Autobahn A20 nördlich von Zurow in 2 Teile getrennt wird. Da sich dieses bei der Vorbesichtigung als zu krautig und kaum begehbar zeigte, entschieden wir, das Sophienholz zwischen den Ortschaften Goldebee, Ravensruh und Nevern erneut aufzusuchen. Ein Teil dieses Waldes wurde ja bereits von uns bei unserer öffentlichen Pilzlehrwanderung am 21.06.2025 besucht. Eine gute Gelegenheit, um zu sehen, wie sich die Artenvielfalt in den letzten 2 Monaten verändert hat.
Das Sophienholz ist ein vielseitiges Laub- und Nadelwaldgebiet auf besseren Böden mit vorwiegend Buchen-, Fichten- aber auch sumpfigen Gebieten. Trotz der seit einigen Tagen vorherrschenden Hitze war das Frischpilzvorkommen unter den schattigen Buchen besser als erwartet. Die Speisepilzsammler unter uns kamen so auch voll auf ihre Kosten.
Hier ein paar Eindrücke und Funde von unserer Exkursion.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Und da waren sie dann auch gleich – Sommersteinpilze (Boletus reticulatus). Die Hutoberfläche ist fein filzig-faserig, die Farbe variiert in verschiedenen hellen Brauntönen. Der Stiel ist meist schlanker als beim Gemeinen Steinpilz.
Foto: Julia Richardt

Und auch Gemeine Steinpilze (Boletus edulis) waren vertreten. Die Hutoberfläche ist feucht glänzend, sonst trocken, kahl und matt in verschiedenen Brauntönen.
Foto: Julia Richardt

Im Vergleich dazu der Gemeine Gallenröhrling (Tylopilus felleus) – ein typischer Verwechslungspartner der Steinpilze. Typisch für den Gallenröhrling ist das braune Stielnetz sowie die im Alter polsterförmig gewölbte rosa gefärbte Porenschicht unter der Huthaut.
Foto: Julia Richardt

Während Sylvina die Steinpilze noch fotografierte, hatte Katarina bereits wieder etwas entdeckt.
Foto: Julia Richardt

Der Graue Wulstling (Amanita excelsa) ist vom Habitus dem Perlpilz sehr ähnlich – allerdings fehlen bei ihm die Rottöne.
Foto: Julia Richardt

Maronen-Röhrlinge (Imleria badia) – ein beliebter und häufiger Speisepilz in bodensauren Nadelwäldern. Der Stiel hat eine braune bis gelblich-braune, stets blassere Farbe als der Hut und eine typische eingewachsene Maserung.
Foto: Julia Richardt

Der Tintenstrichpliz (Bispora antennata) besiedelt vor allem Rotbuchen und ist vom späten Sommer bis Anfang Winter besonders schön auf den Schnittflächen zu sehen.
Foto: Julia Richardt

Der Zaunblättling (Gloeophyllum sepiarium) ist ein holzbewohnender Saprobiont, der hauptsächlich auf Nadelholz wächst.
Foto: Julia Richardt

Im Gegensatz zur Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus) fällt das Hexenei selbiger nicht durch seinen aasartigen Geruch auf und ist sogar essbar. Es riecht und schmeckt rettichartig und kann nach Entfernen der Gallerthülle oder auch nur der Außenhaut roh oder gebraten verzehrt werden.
Foto: Julia Richardt

Es war dieser Rehbraune Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), den man immer an vermoderndem Holz findet. Gerne an Stümpfen oder verrottenden Ästen.
Foto: Julia Richardt

Bereits von der Trockenheit gezeichnete Breitblättrige Rüblinge (Megacollybia platyphylla).
Foto: Julia Richardt

Viele deutsche Namen für einen kleinen Pilz: Grubiger oder Schleimiger Wurzelrübling, Wurzel- oder Wurzelnder Schleimrübling (Hymenopellis radicata).
Foto: Julia Richardt

Es handelte sich hierbei bei um rötende Safranschirmlinge sp. (Chlorophyllum sp.).
Foto: Julia Richardt

Der Kleine Waldchampignon gehört in die Sektion Sanguinolenti = Blut-Egerlinge, die sich bei Verletzung blutrot verfärben.
Foto: Sylvina Zander

Violettstieliger Pfirsich-Täubling (Russula violeipes). Seine Huthaut ist samtig wie die eines Pfirsichs und gelb bis violett gefärbt. Auch sein Stiel ist zumindest im Alter violett überlaufen.
Foto: Julia Richardt

Ältere und trockende Exemplare des Grünen Knollenblätterpilzes (Amanita phalloides). Die Hutoberfläche ist glatt und oft eingewachsen radialfaserig, in feuchtem Zustand etwas klebrig, in trockenem Zustand seidig glänzend
Foto: Julia Richardt

Unser Erinnerungsfoto im Sophienholz.
V.l.n.r.: Julia, Sylvina, Katarina, Gudrun, Catrin
Foto: Dorit Meyer
Die Artenliste aus dem Sophienholz zwischen Nevern, Ravensruh und Goldebee im MTB 2135/221 – Zurow
Kleiner Blut-Egerling (Agaricus silvaticus), Gelber Knollenblätterpilz (Amanita citrina), Grauer Wulstling (Amanita excelsa), Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva), Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), Perlpilz (Amanita rubescens), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Gold-Mistpilz (Bolbitus vitellinus), Gemeiner Steinpilz (Boletus edulis), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Fleischbräunlicher Anistricherling (Clitocybe obsoleta), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Flacher Lachporling (Ganoderma applanatum), Zaunblättling (Gleophyllum sepiarium), Fichten-Wurzelschwamm (Heterobasidion parviporum), Grubiger Wurzelrübling (Hymenopellis radicata), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Maronen-Röhrling (Imlaria badia), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Graugrüner Milchling (Lactarius blennius), Breitblättriger Holzrübling (Megacollybia platyphylla), Langstieliger Knoblauchschwindling (Mycetinis alliaceus), Hexenei der Gemeinen Stinkmorchel (Phallus impudicus), Europäisches Goldblatt (Phylloporus pelletieri), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Frauentäubling (Russula cyanoxantha), Buchenspeitäubling (Russula mairei), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Weißstieliger Ledertäubling (Russula romellii), Harter Zinnober-Täubling (Russula rosea), Grüngefelderter Täubling (Russula verescens), Fleischfarbener Speisetäubling (Russula vesca), Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes), Netzstieliger Hexen-Röhrling (Suillellus luridus), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Gallenröhrling (Tylopilus felleus), Gemeiner Rotfußröhrling (Xerocomellus chrysenteron), Ziegenlippe (Xerocomus submentosus)
09.08.2025 Baum- und Naturwanderung am Görslower Ufer
Geführte Baum- und Naturwanderung
Schwerpunkt Baum- und Pflanzenkunde sowie dazugehörige Pilze, Insekten und Vögel
Görslower Ufer am Schweriner See
09. August 2025
Zu einer Geführten Baum- und Naturwanderung am Görslower Ufer des Schweriner Sees hatten sich am 09. August 2025 insgesamt 18 interessierte Teilnehmer angemeldet. Eingeladen hatten Christian Boss, der sich in der letzten Zeit intensiv mit Bäumen beschäftigt hat, sowie Chris Engelhardt, der den Ruf hat, sich in vielen Bereichen der Natur – u.a. Vögel, Schmetterlinge und andere Insekten – bestens auszukennen. Mit dabei war auch Pilzberaterin Catrin Berseck für den Bereich Pilze.
Auf ging es durch eine blütenreiche Hangwiese, wo vor allem zahlreiche Grünader- und Kleine Kohlweißlinge unterwegs waren.
Der Wanderweg am Görslower Ufer bot mit einem artenreichen Baumbestand jede Menge praktischen Anschauungsunterricht. Nicht nur lernten wir verschiedene Baumarten kennen und unterscheiden – wie zum Beispiel Berg-, Spitz- und Feldahorn oder auch Rot- und Hainbuche, die trotz ihrer deutschen Namen zu zwei ganz verschiedenen Gattungen gehören.
Auch viele Interaktionen zwischen Bäumen und Tieren konnten wir uns anschauen: die Gang- und Platzminen kleiner Nachtfalter zum Beispiel, die in den Blättern bestimmter Baumarten minieren, wie die Ahorn-Zwergmotte (Stigmella aceris), die Kleine Hasel-Zwergmotte (Stigmella microtheriella) oder die Linden-Faltenminiermotte (Phyllonorycter issikii), deren deutsche Namen schon verraten, in den Blättern welcher Baum-Arten sie ihre Fraßgänge bauen.
Auch die Gallen der Ulmenbeutel-Gallmilbe (Aceria campestricola) auf Blättern der Berg-Ulme (Ulmus glabra) oder auf Ahornblättern die Gallen von Vasates quadripedes, der Ahornblattblasen-Gallmilbe zeugen von den erstaunlichen Beziehungen und Wechselwirkungen in der Natur.
Daneben fanden wir auch zahlreiche Pilze: solche, die im Boden die Laubstreu zersetzen, und andere, die als Krusten oder flächige Überzüge direkt als Totholz-Recycler tätig sind. Die auffälligen Wurzelnden Bitter-Röhrlinge (Caloboletus radicans), die wir nahe am Seeufer fanden, gedeihen am besten auf kalkreichen Böden bei Eichen, Linden und Buchen. Andere Pilze sparen sich den ganzen Aufwand, überhaupt Fruchtkörper auszubilden, und wachsen einfach als Myzelien auf dem Substrat – wie zum Beispiel der Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), der als weißer Belag auf Eichenblättern erscheint.
So tauchten wir für gut zweieinhalb Stunden ein in eine faszinierende Welt voller Vielfalt und Wechselwirkungen. Der Resonanz nach zu urteilen, gingen die meisten mit einer Menge neuer Erkenntnisse nach Hause – und manche sogar mit einem gefüllten Pilzkorb.
Anbei ein paar Foto-Eindrücke dieser sehr lehrreichen, gelungenen Exkursion.
Chris (Text, Fotoauswahl und -beschriftung)

Was ist das da auf der Wiese, ein Zitronenfalter? Nein dieser Falter ist kleiner und hat eine auffällige Unterflügel-Zeichnung. Es handelt sich um Colias hyale, die Goldene Acht.
Foto: Christopher Engelhardt

Entlang des Wanderweges am Görslower Ufer erwarteten uns schöne Landschaftseindrücke und ein vielfältiger Baumbestand.
Foto: Christopher Engelhardt

Von links nach rechts: Flatterulme (Ulmus laevis), Hainbuche (Carpinus betulus), Rotbuche (Fagus Sylvatica).
Foto: Christian Boss

Hier vergleichen wir die Blätter von drei Ahorn-Arten: Spitz-, Berg- und Feldahorn.
Foto: Christopher Engelhardt

Die Blätter der Berg-Ulme (Ulmus glabra) haben eine stark asymmetrische Blattbasis mit schlanker, oftmals 3-zipfeliger aufgsetzter Spitze.
Foto: Christopher Engelhardt

Der Rand von Rotbuchen-Blättern erscheint unter der Lupe (oder schon bei genauem Hinsehen) deutlich behaart.
Foto: Christopher Engelhardt

Nahe des Seeufers fanden wir Caloboletus radicans, den Wurzelnden Bitter-Röhrling. Er gilt allgemein als selten und schmeckt extrem bitter.
Foto: Christopher Engelhardt

Der Name Fraxinus excelsior für die Esche deutet schon darauf hin, daß sie andere Bäume an Höhe überragt.
Foto: Christopher Engelhardt

Plötzlich kam ein Falter angeflogen und setze sich bei enem Teilnehmer auf die Kleidung. Bei näherem Hinsehen handelte es sich um einen Nachtfalter: Agrotis segetum, die Saateule.
Foto: Christopher Engelhardt

Auf Lindenblättern fanden wir die Minierspuren von Phyllonorycter issikii, der Linden-Faltenminiermotte, einem winzigen Nachtfalter, der sich eben in Lindenblättern entwickelt. Sie stammt ursprünglich aus Ostasien und wird in Europa vor allem an der Winter-Linde gefunden.
Foto: Christopher Engelhardt

Auf der Blattrückseite der Winter-Linde befinden sich an der Blattader braune Härchen – wodurch sie von der Sommer-Linde zu unterscheiden ist.
Foto: Christopher Engelhardt
02.08.2025 – MTB 1836/3 bei Bastorf
Kartierungsexkursion
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
In der Kühlung bei Bastorf
Messtischblatt Kühlungsborn
02. August 2025
Im MTB 1836/3 Kühlungsborn
Heute trafen sich Angeli und ich zur Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Kühlungsborn.
Die Kühlung ist ein Höhenzug westlich und südlich von Bad Doberan, der recht markant vom Ostseestrand bei Kühlungsborn bis auf knapp 130 m (Dietrichshagener Berg) über den Meeresspiegel aufsteigt. Ein kleines Mittelgebirge direkt oberhalb des Ostseestrandes. Die Nordhänge der Kühlung sind stark zerklüftet mit kleineren Tälern und Senken. Daher der Name Kühlung, denn hier weht oft eine frische Brise von der Ostsee her.
Unser Zielgebiet war das Wichmannsdorfer Holz westlich der Ortschaft Bastorf bei Kühlungsborn. Ein vielseitiges Waldgebiet , in dem sich Fichten- und Buchenwälder abwechseln. Zurück ging es dann am nördlichen Waldrand mit Blick auf die Ostsee.
Trotz des angesagten Regens trafen wir uns am Parkplatz beim Hohen Niendorfer Abenteuerplatz und gingen den Waldweg in Richtung Wichmannsdorf. Auf den ersten Metern begegeneten uns kaum Pilze – selbst in einem vielversprechend aussehenden Buchenabschnitt zeigte sich nicht ein einziger Frischpilz.
Wir versuchten unser Glück dann auf einer kleinen mit Altbuchen bestandenen Erhebung mit viel liegendem Totholz und wurden dann dort tatsächlich fündig. So viele Frischpilze hatten wir lange nicht gesehen. Eine kurze Stippvisite im mit Brombeeren durchsetzten Fichtenabschnitt sah dagegen wieder recht trostlos aus. Unser Weg führte uns dann weiter zum nördlichen Wandrand in einen kleinen Waldrandbereich mit vorwiegend Jungeichen und Birken und schließlich an einer schönen Altbuchenkante zurück zum Parkplatz.
Während es in anderen Gebieten Mecklenburgs kräftige Schauer gab, hatten wir mit dem Wetter Glück. Und auch mit den gefundenen Pilzen – wir konnten immerhin über 50 Arten für unsere Kartierung aufschreiben. Dazu gab es für uns Beide noch einen gut gefüllten Korb mit Speisepilzen.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Angeli und ich trafen uns am Parkplatz beim Hohen Niendorfer Abenteuerplatz, wo dieser Leuchtturm mit Infotafeln steht.
Foto: Angeli Jänichen

Ich brachte brachte bereits einige Pilze mit, um sie Angeli zu zeigen und zu erklären.
Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Abenteuerspielplatz befinden sich auch einige Sitzgelegenheiten, die zum Picknick einladen. In unserem Fall nutzten wir die aber für Bestimmungsübungen.
Foto: Angeli Jänichen

Gleich am Wegrand begrüßten uns die allgegenwärtigen Dickschaligen Kartoffelboviste(Scleroderma citrinum).
Foto: Angeli Jänichen

Nachdem wir auf den ersten hundert Metern überhaupt nichts fanden, erreichten wir einen Buchenberg. Die Freude war groß, als wir endlich diesen ersten bereits arg in Mitleidenschaft gezogenen Täubling fanden.
Foto: Angeli Jänichen

Aber es sollte nicht bei diesem einen Täubling bleiben… Hier gleich das nächste Exemplar: Frauentäubling (russula cyanoxantha).
Foto: Angeli Jänichen

Ein kleiner Buchenwaldabschnitt mit Blick auf eine umliegenden Fichtenwaldabschnitt.
Foto: Angeli Jänichen

Daneben thronte gleich dieser wunderschöne Sklerotienporling (Polyporus tuberaster).
Foto: Angeli Jänichen

Und da war dann auch endlich der erste Sommersteinpilz (Boletis reticulatus). Im Gegensatz zum Gemeinen Steinpilz (Boletus edulis) hat der Sommersteinpilz einen trockenen, feinfilzigen Hut und der Stiel ist in ganzer Länge von einem Netzmuster überzogen.
Foto: Angeli Jänichen

Aber auch Gemeine Steinpilze (Boletus edulis) waren bereits vertreten. Der Hut ist meist etwas speckig glänzend, zum Rand hin heller und oft mit einem deutlich weißen Randsaum. Der Stiel hat meist nur im oberen Teil eine feine weiße Netzzeichnung.
Foto: Angeli Jänichen

Und über diese Grüngefeldeten Täublinge (Russula virescens) freuten wir uns besonders. Er gehört zu den schmackhaftesten Täublingen und ist aufgrund seiner felderig aufreißenden Huthaut auch leicht zu erkennen.
Foto: Angeli Jänichen

Der Dickblättrige Schwärz-Täubling (Russula nigricans) ist ein großer stattlicher Pilz. Aufgrund seiner dicken, sehr entfernt stehenden Lamellen und des erst rötenden und dann schwärzenden Fleisches ist der Dickblättrige Schwärz-Täubling mit keinem anderen Täubling zu verwechseln. Ein Pilz, der jung und weiß essbar ist – in diesem Alter natürlich nicht mehr.
Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir einmal im Detail die sehr weit auseinander stehenden ungewöhnlich dicken und starren Lamellen. Unter Druck splittern sie sofort und laufen ziegelrot an, bis sie nach einiger Zeit gräulich-schwarz werden.
Foto: Angeli Jänichen

Während Angeli fleißig fotografierte, ging ich weiterhin auf Pilzsuche und fand auf diesem kleinen Buchenhügel immer mehr.
Foto: Angeli Jänichen

So auch eine größere Gruppe Flockenstieliger Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus).
Foto: Angeli Jänichen

Breitblättrige Holzrüblinge (Megacollybia platyphylla) erscheinen auf dem Waldboden und sind stets durch weiße Myzelstränge mit im Substrat verborgenem Holz verbunden.
Foto: Angeli Jänichen

Gemeine Hundsrute (Mutinus caninus) – eine Pilzart aus der Familie der Stinkmorchelverwandten. Der lateinische Name des Pilzes Mutinus caninus bedeutet übrigens übersetzt „Kleiner Hundepenis“…
Links sehen wir ein Hexenei.
Foto: Angeli Jänichen

Die giftigen Zimtfarbenen Weichporlinge (Hapalopilus rutilans) waren zwischen dem herumliegenden Totholz ebenfalls vertreten.
Foto: Angeli Jänichen

Wir wechselten dann auf die andere Seite des Weges in einen Nadelholzbereich. Da er sehr mit Brombeeren durchwuchert war, fanden wir kaum etwas für unsere Kartierung und wechselten schnell in einen mit vorwiegend Birken bewachsenen Wegbereich.
Foto: Angeli Jänichen

Hier sah es dann schon wieder besser aus. Zunderschwamm (Fomes fomentarius) auf totem Birkenholz.
Foto: Angeli Jänichen

Grauer Scheidenstreiling (Amanita vaginata) mit hellgrauen und häutigen Velumresten auf dem Hut.
Foto: Angeli Jänichen

Vergleich zwischen dem Rotbraunen Scheidenstreifling (Amanita fulva) und dem Grauen Scheidenstreifling (Amanita vaginata).
Foto: Angeli Jänichen

Und dann begegneten wir noch diesen düsteren Gesellen. Rußbraune Riesenschirmpilze bzw. Parasole (Macrolepiota procera var. fuliginosa) – eine dunkle Variation des Parasols.
Foto: Angeli Jänichen

Und das ist unsere gesamte Ausbeute an Speisepilzen von heute – fast alles nur auf einem kleinen Buchenberg gefunden.
Foto: Angeli Jänichen
Die Artenliste aus dem Wichmannsdorfer Holz bei Bastorf – MTB: 1836-341 SW:
Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva), Perlpilz (Amanita rubescens), Grauer Scheidenstreifling (Amanita vaginata), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta), Gemeiner Steinpilz (Boletus edulis), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Blasser Laubwaldpfifferling (Cantharellus pallidus), Eichen-Wirrling (Daedales quercina), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Zaunblättling (Gleophyllum sepiarium), Knopfstielieger Rübling (Gymnopus confluens), Gemeiner Waldfreund-Rübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus personatus), Zimtfarbener Weichporling (Hapalopilus rutilans), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hypoxylon cohaerens), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Schwefelporling – alte FK (Laetiporus sulphureus), Blutmilchpilz (Lycogala edidendrum), Rußbrauner Riesenschirmpilz (Macrolepiota procera var. Fuliginosa), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Breitblättriger Rübling (Megacollybia platyphylla), Gemeine Hundsrute (Mutinus caninus), Flockenstieliger Hexenröhrling (Neoboletus erytrophus), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Sklerotienporling (Polyporus tuberaster), Ampfer-Rost (Ramularis rubella), Orangeroter Heftelnabeling (Rickenella fibula), Purpurschwarzer Täubling (Russula atropurpurea), Frauen-Täubling (Russula cyanoxanthas), Dickblättriger Schwärztäubling (Russula nigricans), Dichtblättriger Schwärztäubling (Russula densifolia), Buchenspeitäubling (Russula mairei), Blaugrüner Reiftäubling (Russula parazurea), Fleischroter Speisetäubling (Russula vesca), Grüngefelderter Täubling (Russula virenscens), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Netzstieliger Hexenröhrling (Suillellus luridus), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Wurzelnder Schleimrübling (Xerula radicata)
30.07.2025 – MTB 2135/1 zwischen Lübow und Maßlow
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Zurow
30. Juli 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2135/1 – Zwischen Lübow und Maßlow
Unsere Kartierungsexkursionen führen uns ab jetzt in das MTB 2135 Zurow – direkt östlich neben dem MTB 2134 Wismar. Wir – Dorit, Sylvina, Hanjo und ich – trafen uns auf dem Parkplatz in Zurow. Von dort ging es mit einem Auto in das ausgewählte Kartierungsgebiet. Wir fuhren von Zurow über Fahren-Ausbau einen abenteuerlichen Weg zum Schmiedesee.
Auf sandig–lehmigen Böden wechseln sich hier auf teils hügeligem Gelände Laub- und Nadelwälder, Wiesen und Felder ab. Wir finden hauptsächlich Fichten- und Kiefernforste vor – durchsetzt mit Eichen, Buchen und Ahorn. Das gesamte Waldgebiet ist sehr verkrautet mit viel Unterholz – nicht unbedingt das ideale Gebiet für Speisepilzsammler. Aber uns ging es ja um die Bestandsaufnahme der an dem Standort wachsenden Pilze.
Da der südliche Teil des kleinen Sees außerhalb unseres Kartierungsgebietes liegt, gingen wir erst einmal ein Stück nördwärts den Weg in Richtung Kahlenberg und sahen uns am Wegrand und dem angrenzenden Feld und Freiflächen um.
Hanjo fand dann in dem uns völlig unbekannten Gebiet einen Weg in den ansonsten kaum begehbaren Wald. Wir erreichten dann das Ufer des Schmiedesees und beschlossen, ihn einmal zu umrunden. Da es sich um einen vom Anglerverband bewirtschafteten See handelt, fanden wir auch einen gut begehbaren Weg am Ufer.
Hier wieder einige Eindrücke und Pilzfunde von dieser Kartierung.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Zu Beginn unserer Exkursion sahen wir uns am Wegrand auf einer Ruderalfläche um unter einer alten Eiche um.
Foto: Hanjo Herbort

Diese Königskerze (Verbascum) war uns ein Foto wert. Im Hintergrund sehen wir den Waldbereich, den wir anschließend aufsuchten.
Foto: Hanja Herbort

Unser erster Fund – junge Parasole bzw. Riesenschirmpilze (Macrolepiota procera) im Brombeergestrüpp.
Foto: Hanjo Herbort

In den Nadelwaldbereichen gab es neben Kiefern auch Douglasien sowie viel Totholz.
Foto: Hanjo Herbort

Der Kiefern-Braunporling (Phaeolus spadiceus) bevorzugt Kieferforste, die mehr oder weniger stickstoffbelastet sind.
Foto: Hanjo Herbort

Der Klebrige Hörnling (Calocera viscosa) wächst an totem Nadelholz, oft an den Stümpfen von Fichten.
Foto: Hanjo Herbort

Junger Zimtfarbene Weichporling (Hapalopilus rutilans) an Hasel. Der einzige giftige Porling.
Foto: Sylvina Zander

Ausgeblichene Gemeine bzw. Lila Rettich-Helmlinge (Mycena pura). Zu erkennen ist dieser an ihrem rettichartigen Geruch. Er lebt als Saprobiont in Laub- und Nadelwäldern.
Foto: Hanjo Herbort

Ältere Knopfstielige Rüblinge (Collybiopsis confluens). Die Fruchtkörper erscheinen meist büschelig in Reihen oder Hexenringen.
Foto: Sylvina Zander

Auf verwesenden Laubblättern kann man bei feuchter Witterung den Postament-Helmling (Mycena stylobates) finden. Die Art ist leicht am meistens stark vorhandenen Basalscheibchen am Stielgrund (Postament) erkennen.
Foto: Hanjo Herbort

Pflaumen-Feuerschwamm (Phellinus tuberculosus) – und das auch noch an Pflaumenbäumen. Der Pilz verursacht im Holz eine Weißfäule.
Foto: Hanjo Herbort

Hier die eckig, labyrinthisch und lang gezogenen Porenschicht der Rötenden Tramete.
Foto: Catrin Berseck

Das Zottige Weidenröschen (Epilobium hirsutum), auch Rauhaariges Weidenröschen genannt. Es gibt auch mehrere Pilze, die vom Zottigen Weidenröschen leben. Da Torsten und Phillip nicht waren – beschäftigten wir uns damit aber nicht.
Foto: Hanjo Herbort

Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum) im Uferbereich. WEnn sie solche Form haben, ist es gut möglich, dass sie später vom Parasitische Röhrling (Pseudoboletus parasiticus) besiedelt werden.
Foto: Hanjo Herbort

Und wie sagte Reinhold immer: „Das Beste kommt zum Schluss.“. Und das war auch heute so. Zum Abschluss der Exkursion ließen wir nochmals unsere Blicke auf die Ruderalfläche schweifen.
Foto: Hanjo Herbort

Für uns alle ein Erstfung: Ein Sklerotium des Mutterkorns (Secale cornutum) des Mutterkornpilzes (Claviceps purpures) auf Gerste. Bei der Reife des Getreides fallen sie mit den Samenkörnern auf den Erdboden und im kommenden Frühjahr wachsen aus ihnen kleine gestielt-kopfige Fruchtkörper, die zu den Ascomyzeten (Schlauchpilzen) gehören.
Für Mensch und Tier stellt der Befall von Nahrungs- und Futtergetreide mit Mutterkorn ein Problem dar, denn die in diesem Pilz enthaltenen über 80 Alkaloide und Farbstoffe weisen eine hohe Giftigkeit auf. Im Mittelalter traten auf Mutterkorn zurückgehende Massenvergiftungen – Antoniusfeuer genannt – auf.
Foto: Hanjo Herbort
Die Artenliste aus dem vom Schmiedesee zwischen Lübow und Maßlow – MTB: 2135-143 NW:
Perlpilz (Amanita rubescens), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Rötende Tramete (Daedaleopsis confragosa), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Weiße Lohblüte (Fuligo candila), Knopfstieliger Rübling (Gymnopus confluens), Gemeiner Waldfreundrübling (Gymnopus dryophilus), Zimtfarbener Weichporling ( Hapalopilus rutilans), Goldschimmel (Hyomyces chrysosoermus), Parasol (Macrolepiota procera), Nelkenschwindling (Marasmius oreades), Lila Rettichhelmling (Mycena pura), Postament-Helmling (Mycena stylobates), Nadelholzbraunporling (Phaeolus spadiceus), Pflaumenfeuerschwamm (Phellinus tuberculosus), Behangener Faserling (Psathyrella candolleana), Blaugrüner Reiftäubling (Russula parazurea), Dickschaliger Kartoffelbovist (Sclreoderma sitrinum), Mutterkorn (Secale cornutum), Samtfußkrempling (Tapinella atromentosa), Langstielige Ahornholzkeule (Xylaria Longpipes)
Pilze und Wetter August 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im August 2025
01.08.2025 – Freitag

Das von mir vergessene Standort-Foto vom Sommer-Steinpilz (Boletus reticulatus) reicht Irina nach…
Foto: Irina Gräber
Heute habe ich selber sehr viel gefunden – zeige euch das aber später.
Ich freue mich immer wieder, wenn Freunde, Bekannte oder Leser des Tagebuches uns Fotos von ihren Pilzfunden schicken.
So wie Irina aus Rostock heute, die mir Fotos von ihren Funden aus dem Raum Rostock zugesandt hat.
Auch unser Pilzfreund Andreas Herchenbach war erfolgreich. Er beobachtet seit Jahren das Wetter und Pilzwachstum ganz genau und weiß, dass die Körnchenröhrlinge ca. 10 Tage nach größeren Niederschlägen wachsen. Am 20.07. und 21.07. gab es im Raum Wismar größere Niederschlagsmengen – also Grund für ihn, heute danach zu schauen – und das auch noch erfolgreich.
Deswegen führen wir dieses Tagebuch auch in Reinhold´s Art und Weise unter „Pilze und Wetter“ weiter – auch wenn uns das fundierte Wissen von Reinhold über das Wetter fehlt.
Catrin

Nach den vielen Regenfällen starten auch die Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) an vorwiegend Buchenstämmen wieder durch.
Foto: Irina Gräber

So sieht ein Sammelkorb aus, wenn man sich etwas mehr mit Pilzen beschäftigt und sich etwas besser auskennt.
Foto: Irina Gräber

Die bereits zur Weiterverarbeitung geputzten Körnchenröhrlinge (Suillus granulatus) von Andreas.
Foto: Andreas Herchenbach
02.08.2025 – Sonnabend
Heute stand eine öffentliche Wanderung inkl. Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Kühlungsborn an. Angeli und ich bestritten das heute alleine in der Nähe von Bastorf. Und das dazu auch noch sehr erfolgreich – über 50 Arten konnten wir bestimmen und für die Kartierung aufschreiben – dabei endlich mal auch viele Pilze mit Hut und Stiel.
Dazu gab es dann für uns zur Belohnung auch noch einen sehr vollen Korb mit Speisepilzen für uns beide. Steinpilze, Hexenröhrlinge, verschiedene Täublinge und Parasole – um nur einige hier schon vorab zu nennen. Den ausführlichen Bericht gibt es wie immer gesondert und etwas später.
Aber auch in anderen Regionen geht das Pilzwachstum richtig los. Corina ist in der Müritzer Region ebenfalls mit einem prall gefüllten Korb nach Hause gegangen.
Catrin

Junge Flockenstielige Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus) in der Müritz-Region.
Foto: Corina Peronne

Junge madenfreie Netzstielige Hexen-Röhrlinge (Suillellus luridus) – ebenfalls bei Corina in der Müritz-Region.
Foto: Corina Peronne

Die Funde von Corina und ihrer Familie von heute. Es lohnt sich jetzt schon mal, das Dörrgerät raus zu holen und den Wintervorrat anzulegen.
Foto: Corina Peronne
03.08.2025 – Sonntag

Ein teilweise komplett unterschätzter kleiner würziger Speisepilz – der Nelkenschwindling (Marasmius oreades)
Foto: Irina Gräber
Es müssen nicht immer Steinpilze, Hexenröhrlinge oder Pfifferlinge sein. Es gibt noch viele andere sehr schmackhafte Speisepilze.
Auf Wiesen und grasigen Wegrändern und in Parkanlagen findet man jetzt aufgrund des vielen Regens in Massen frische Nelkenschwindlinge (Marasmius oreades).
Erkennungsmerkmale sind seine dicklichen, etwas entfernt stehenden Lamellen. Er hat einen sehr festen und zähen Stiel – wenn man ihn sammelt, hat man meist den ganzen Pilz in der Hand. Das unterscheidet ihn unter anderem auch von anderen kleinen ähnlichen Pilzen, deren Stiele meist zerbrechlich und zart sind.
Der Geruch wird unterschiedlich beschrieben: nach Bittermandel, Blausäure, Sägespänen, Gewürznelken, etwas alkalisch stechend, dennoch angenehm pilzig. Insgesamt aromatisch.
Und das macht ihn zu einem sehr guten Speisepilz für helle Suppen und -soßen oder als Gemüsepilz. Die zähen Stiele sind dabei zu entfernen. Er eignet sich auch zum Trocknen und zur Herstellung eines würzigen Pilzpulvers.
Catrin

Auch Phillip ist auf den Geschmack gekommen und sammelt die kleinen Pilze. Am besten lassen sie sich mit einer Schere ernten.
Übrigens – so sieht ein perfekter Sammelkorb aus. Man spart sich zu Hause viel Arbeit, wenn man nicht erst noch die Erde aus den Lamellen putzen muss.
Foto: Phillip Buchfink
04.08.2025 – Montag

Sommer- oder Eichen-Steinpilz (Boletus reticulatus) – unter anderem zu erkennen an seinem weißen sehr ausgeprägten Netzmuster, das sich manchmal bis zur Stielbasis nach unten erstreckt.
Foto: Corina Peronne
Eigentlich wollte ich heute über das Wetter und das damit verbundene Pilzwachstum berichten und euch seltenere Funde von letzter Woche nachreichen… Aber aufgrund der vielen zugesandten Fotos von Steinpilzen – vor allem Sommersteinpilzen habe ich mich umentschieden.
Diese Internetseite heißt ja schließlich „Der Steinpilz“ – also gibt es die heute geballt aus verschiedenen Regionen Mecklenburg-Vorpommerns präsentiert.
Hauptsächlich sind derzeit in Massen Sommer- oder Eichen-Steinpilze (Boletus reticulatus) zu finden – wie die nachfolgenden Fotos beweisen.
Aber wo findet man die Sommersteinpilze? Wie alle Dickröhrlinge ist der Sommer-Steinpilz ein Mykorrhizapilz, der in Mitteleuropa ausschließlich mit Laubbäumen, vor allem Eichen und Buchen zusammenlebt. Er kann derzeit vorwiegend in parkähnlichen Biotopen oder Eichen-Alleen gefunden werden – aber auch in Laubwäldern mit Eichen und Buchen.
Also liebe Speisepilzsammler – haltet jetzt in diesen Gebieten Ausschau! Ich wünsche euch viel Glück bei eurer Suche – so wie es die Finder hier auch hatten. Alle Funde und Fotos sind aktuell von heute.
Catrin

Auch Andreas war in der näheren Umgebung Wismars sowohl beim Sammeln von Sommer- und Gemeinen Steinpilzen erfolgreich.
Foto: Andreas Herchenbach
05.08.2025 – Dienstag

Der bei Speisepilzsammlern beliebte Maronenröhling (Imleria badia) am 04.08.2025 am Standort.
Foto: Corina Peronne
Nach der langen Trockenheit und den vielen Niederschlägen in letzter Zeit ist das Pilzwachstum durch alle Gattungen und Arten mächtig gestiegen. Das betrifft natürlich die essbaren und giftigen Arten.
Auf den Wiesen, Weiden und Rasenflächen findet man derzeit Champignons verschiedener Arten, die Parasole grüßen massenweise am Straßenrand, in Wäldern und Wiesen.
Vor allem die Steinpilze (sowohl Sommersteinpilze als auch bereits der Gemeine Steinpilz) und die Netz- und Flockenstieligen Hexenröhrlinge und andere bei den Speisepilzsammlern beliebte Röhrlinge wachsen derzeit in Massen. Man sagt immer, dass Röhrlinge „Anfängerpilze“ sind, da es zwar unter ihnen ungenießbare und Magen-Darm-Giftige, aber keine tödlich giftigen Arten gibt.
Deswegen möchten wir euch heute ein paar ungenießbare bzw. leicht giftige Röhrlinge vorstellen. Weitergehende Informationen dazu findet ihr auf Phillips Website unter https://butterbeidiepilze.de/speisepilze/ . Phillip hat das dort sehr schön erklärt, so dass wir das gerne hier verlinken und nicht genauer darauf eingehen.
Catrin

Der Gemeine Gallenröhrling bzw. auch Bitterling (Tylopilus felleus). Der wissenschaftliche Name leitet sich von griechisch tylo „Kissen“ und lateinisch pilus „Kappe“ sowie felleus „gallig, gallenbitter“ ab und bedeutet auf Deutsch „gallenbittere Kissenkappe“. Der klassische Verwechslungspartner mit dem Steinpilz, der ein Pilzgericht schon mal gallebitter und ungenießbar werden lässt.
Foto: Phillip Buchfink

Der Wurzelnde Bitter-Röhrling (Caloboletus radicans) wird oft von Pilzsammlern mit Steinpilzen verwechselt. Der Stiel des Wurzelnden Bittterröhrlings ist allerings gelblich mit gelbbräunlichem Netz, auf Druck rötlich oder braunrot fleckend. Zur Basis hin spitzt er meist deutlich zu, worauf sein Namenszusatz “wurzelnd” hinweist.
Foto: Maria Schramm

Satans-Röhrlinge (Rubroboletus satanas) am 03.08.2025. Pilzsammler haben oft Angst, diesen Pilz mit den ebenfalls rotporigen essbaren Hexen-Röhrlingen zu verwechseln. Der Satansröhrling hat einen sehr starken Farbkontrast zwischen blutroter Unterseite und bleichem Hut – auch unterscheidet er sich deutlich am Stiel mit seinem roten Netz auf gelbem Grund, das zuletzt düster blutrot wird. Der Satansröhrling ist bei uns im Mecklenburg/Vorpommern sehr selten anzutreffen.
Foto: Phillip Buchfink
06.08.2025 – Mittwoch
Wer nicht erst Ende September seine Pilzsaison beginnt, findet derzeit die schönsten Sommersteinpilze. Aber auch der Gemeine bzw. Fichtensteinpilz ist bereits vereinzelt zu finden.
Die ergiebigen Regenschauer nach der längeren Trockenphase sind für diesen Wachstumsschub verantwortlich.
Aber auch andere Röhrlinge sind nach den Regenfällen der letzten Tage in Massen zu finden. Netzstielige Hexenröhrlinge findet man derzeit zum Beispiel in Parkanlagen – vorwiegend unter Linden. Die Flockenstieligen Hexenröhrlinge wird man in den nächsten Tagen auch wieder vermehrt finden.
Aber auch die Liebhaber der Schmierröhrlinge kommen jetzt auf ihre Kosten. Der Wachstumsschub der Körnchenröhrlinge ist fast durch, allerdings beginnt er jetzt bei Lärchenröhrlingen.
Catrin

Pfeffer-Röhrlinge (Chalciporus piperatus) sind mit ihrem pfeffrig-scharfen Geschmack nicht nur gute Würzpilze. Sie sind nach dem Mehlräsling Steinpilzanzeiger Nr. 2.. Die dunkel orange-braunen Röhren mit ihren eckigen Röhrenmündungen sind am Stiel angewachsen und dunkler als der Hut.
Foto: Catrin Berseck

Auch Körnchen-Röhrlinge oder Schmerlinge (Suillus granulatus) sind derzeit noch unter Kiefern zu finden. Zu erkennen an ihren Flüssigkeitströpfchen an Stiel und Röhren.
Foto: Catrin Berseck

Der Gold-Röhrling oder Goldgelbe Lärchen-Röhrling (Suillus grevillei) hingegen wächst ausschließlich bei Lärchen. Er ist gold- bis orangegelb und die Huthaut ist bei feuchter Witterung stark schleimig.
Foto: Catrin Berseck

Ebenfalls ein Kiefernbegleiter ist der Butterpilz bzw. Butter-Röhrling (Suillus luteus). Im Gegensatz zu den anderen beiden Schmierröhrlingen hat er einen braunvioletten Ring. Standortfoto vom 07.08.2025
Foto: Catrin Berseck
07.08.2025 – Donnerstag
Heute habe ich in der Mittagspause mal wieder das benachbarte Wäldchen aufgesucht. Bereits letzte Woche war ich dort und habe mich über das Pilzwachstum gefreut. Steinpilze gab es dort auch – aber davon habe ich die letzten Tage genug gezeigt.
Aber noch größer war die Freude darüber, dass ich dort an mehreren Stellen Orchideen entdeckt habe. Orchideen – so auch die Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis helleborine) haben im gewissen Sinne auch etwas mit Pilzen zu tun. Die Pflanze bildet sehr kleine Samen aus, die windverbreitet werden und keine Nährstoffe für die Keimung enthalten. Daher ist die Pflanze zur Keimung auf Pilze (Mykorrhiza) angewiesen.
Heute gab es außerdem viele Perlpilze (Amanita rubescens) – darunter sogar den seltenen Gelbberingten Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea).
Catrin

Gelbberingter Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea). Er unterscheidet sich vom gewöhnlichen Perlpilz in erster Linie durch die gelben Farbnuancen, besonders am Ring und den dünnen, kleineren Wuchs.
Foto: Catrin Berseck

Im Vergleich:
Links: Perlpilz (Amanita rubescens) – Rechts: Gelbberingter Perlpilz (Amanita rubescens var. annulosulphurea).
Foto: Catrin Berseck

Und zum Schluß noch etwas Schönes. Der Ohrlöffel-Stacheling (Auriscalpium vulgare) wächst fast ausschließlich auf Kieferzapfen.
Foto: Catrin Berseck
08.08.2025 – Freitag
Heute stand nach Feierabend auf dem Heimweg mal ein kurzer Besuch in einem kalkhaltigen Buchenwald an. Dort war ja in den letzten Tagen so gut wie gar nichts an Frischpilzen zu finden. Um so mehr war ich heute überrascht.
Es zeigten sich ein paar Gemeine Steinpilze – wenn auch nicht in Massen, wie die Sommersteinpilze. Täublinge wachsen wieder, die Flockenstieligen Hexenröhrlinge lassen sich noch etwas Zeit – davon sah ich kaum welche.
Aber die Raufußröhrlinge starten jetzt mächtig durch. Dazu gehören sowohl Pilze aus der Gattung Leccinum und Leccinellum, die im deutschen Sprachraum aufgrund der schuppigen und rauen Stieloberfläche auch als Raufüße, Raufußröhrlinge oder Raustielröhrlinge bezeichnet werden. Sie sind teilweise eng an bestimmte Baumarten gebunden.
Und dann war ich tatsächlich überrascht, dass ich jetzt schon Herbsttrompeten finden konnte, die sich in den letzten 3 Jahren etwas rar gemacht haben.
Catrin

Der Gemeine Birkenpilz (Leccinum scabrum) ist ein Mykorrhizapartner der Birkenarten.
Foto: Catrin Berseck

Hainbuchen-Raufüße bzw. Hainbuchen-Röhrlinge (Leccinellum pseudoscabrum) sind Mykorrhiza-Pilze, die mit der Hainbuche vergesellschaftet sind. Hainbuchen sind übrigens trotz ihres Namens nicht mit den Buchen verwandt, sondern gehören zu den Birkengewächsen.
Foto: Catrin Berseck

Die Herbst- bzw. Totentrompeten (Craterellus cornucopioides) haben scheinbar wieder ein gutes Jahr. Heute am 08.08.2025 am Standort.
Foto: Catrin Berseck

Der botanische Artname bezeichnet treffend die Form: cornucopioides = füllhornförmig.
Foto: Catrin Berseck
09.08.2025 – Sonnabend
Heute fand die von Christian initiierte Baumwanderung am Görslower Ufer des Schweriner Sees statt. Der Fokus dieser Veranstaltung lag auf auf dem Erkennen und Bestimmen von Bäumen. Da aber in der Natur alles miteinander verbunden und verwoben ist, blieb es natürlich nicht nur bei den Bäumen. Chris erklärte uns Insekten und auch auf die gefundenen Pilze sind wir natürlich eingegangen.
Diese Wanderung fand großen Anklang und war mit 18 Teilnehmern auch gut besucht. Den Bericht darüber könnt ihr demnächst lesen.
Im Anschluss daran beschloss der Großteil der Teilnehmer noch, den naheliegenden Landschaftspark in Rabensteinfeld aufzusuchen. Je nach Interessenlage wurde sich intensiver mit Bäumen oder Pilzen beschäftigt.
Es war ein sehr schöner und lehrreicher Tag, an dem auch die Pilzliebhaber mit gefüllten Körben nach Hause gingen.
Catrin
10.08.2025 – Sonntag
Nach der gestrigen Wanderung am Görslower Ufer besuchte ich noch bei mir in der Nähe die Stelle, wo der seltene Falsche Satansröhrling bzw. Le Gal‘s Purpurröhrling (Rubroboletus legaliae) vorkommt. Vor 3 Tagen war noch nichts von ihnen zu sehen – aber gestern waren tatsächlich zu meiner Freude mehrere Exemplare da!
Leider schon einige Pilze von übereifrigen Pilzsammlern abgeschnitten und raus gerissen… Den Maden sei Dank, wurden die abgeschnittenen Pilze liegen gelassen, so dass ich noch Fotos machen konnte.
Dieser Pilz steht auf der Roten Liste in der Kategorie 1 – das bedeutet, dass er vom Aussterben bedroht ist und nach Bundesartenschutzverordnung streng geschützt ist.
Da dieser Pilz so selten ist und ihn kaum Jemand zu Gesicht bekommt, hier noch ein paar schöne Fotos.
Catrin

Der Hut von Le Gal’s Purpur-Röhrling ist rosa bis rosarot, der Stiel gelb und abwärts zunehmend rot mit einem roten Stielnetz.
Foto: Catrin Berseck

Das Stielnetz ist zur Stielspitze – also dem oberen Teil des Stieles – gelb, abwärts schnell rot werdend. Die Maschen des Netzes sind rundlich bis meist langgezogen und die Stielbasis rotflockig punktiert.
Foto: Catrin Berseck
11.08.2025 – Montag
Nachdem ich unseren Raritätenjäger Andreas Okrent von meinem gestrigen Fund informiert habe, hat er es sich nicht nehmen lassen, sofort am Sonntag früh vorbei zu kommen und den Schnecken zuvor zu kommen, um sich diesen seltenen Fund persönlich anzusehen und Fotos zu machen. Le Gal’s Purpur-Röhrling fehlte ihm nämlich noch in seiner Raritäten-Sammlung.
Andreas und ich begannen unsere private Wanderung erst einmal früh morgens in meinen Revieren, fuhren dann zum bekannten Standort des Satansröhrlings (Rubroboletus satanas), der sich endlich zu unserer Freude auch zeigte.
Anschließend ging es mittags mit vielen Pilzarten im Gepäck weiter zu Phillip´s Öffentlicher Wanderung, die Phillip den Teilnehmern im Anschluss an seine Wanderung noch zeigen und erklären konnte.
Auf dem Rückweg suchten wir dann noch kurz ein Gebiet auf, wo wir auch ein paar seltene Pilze vermuteten. Und wir wurden nicht enttäuscht.
Ich hoffe, dass auch der normale Speisepilzsammler Freude und Interesse an diesen seltenen Pilzen hat – ansonsten habe ich aber auch noch ein paar gefundene Speisepilze eingestreut.
Heute nur mal nur als Fotodokumentation ohne Erklärungen von einem Teil der Funde – der Rest folgt morgen.
Catrin
12.08.2025 – Dienstag

Dieser seltene Marmorierte bzw. Gehämmerte Röhrling (Hemileccinum depilatum) ist ein Mykorrhizapartner der Hainbuche an wärmebegünstigten Standorten und nur selten bis zerstreut zu finden.
Foto: Catrin Berseck
Heute nun der 2. Teil der am Sonntag gefundenen Raritäten – davon einige Pilze, die auf der Roten Liste stehen und in ihrem Bestand gefährdet sind. Neben dem Satans-Röhrling und Le Gal’s Purpur-Röhrling auch noch ein dritter Pilz aus der Gattung der Rubroboleten – der Blasshütige Purpurröhrling. Das sind Pilze mit einem einem gräulich-roten bis leuchtend roten oder dunkelroten Hut und einem rosafarbenen bis rotem Stielnetz.
Andreas und ich waren jedenfalls begeistert und ich hoffe, ihr könnt euch auch an diesen schönen Pilzen erfreuen.
Ansonsten hatte ich heute nach Feierabend eine sehr schöne private Wanderung mit einer Urlauberin aus Bayern. Im Fokus standen die Herbsttrompeten, die sie vorher noch nie gefunden hat. Aber auch das Kennenlernen neuer Speise- und Giftpilze. Am Ende unserer 3 stündigen abendlichen Tour konnte sie einen bunten artenreichen Korb mit Speisepilzen mit in ihre Ferienunterkunft nehmen – siehe letztes Foto.
Falls ihr auch mal eine individuelle Pilzwanderung machen möchtet – meldet euch gerne unter den auf der Website angegebenen Kontaktdaten.
Catrin

Ein leider schon sehr lädiertes Exemplar eines Stachelschuppigen bzw. Einsiedler-Wulstlings (Amanita solitaria).
Foto: Catrin Berseck

Merkmale des Gelbflockigen Wulstlings sind die gelben Flocken auf der Huthaut sowie im unteren Bereich des Stiels.
Foto: Catrin Berseck

Der Veilchenblaue Schönkopf wächst als Streuzersetzer in Laub-, Nadel- und Auwäldern, gern an Wegrändern. Er bevorzugt feuchte kalkhaltige Böden.
Foto: Catrin Berseck

Der Blasshütige Purpurröhrling ist ein seltener Symbiosepilz und typischer Laubwaldbewohner. Die Art bevorzugt die Buche als Symbiosepartner und kalkreiche Böden.
Foto: Andreas Okrent

Der Hut des Blasshütigen Purpur-Röhrlings ist zartrosa, Fraßstellen anfangs gelb, jedoch rötlich umfärbend. Die Poren sind leuchtend blutrot, der Stiel zitronengelb mit einem deutlich ausgeprägten Stielnetz.
Foto: Catrin Berseck

Und so kann das Sammelergebnis nach einer privaten Wanderung aussehen – viele essbare Pilzarten, die ansonsten wahrscheinlich nicht im Sammelkorb gelandet wären.
Foto: Martina Simmerl
13.08.2025 – Mittwoch

Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) heute bei unserer Kartierungsexkursion im Sophienholz bei Nevern.
Foto: Sylvina Zander
Heute trafen wir uns wieder zur unserer Mittwochsexkursion in Zurow, um unsere Kartierung im 2. Quadranten des MTB Zurow fortzusetzen.
Uns standen mehrere Bereiche nordöstlich von Zurow zur Verfügung – wir entschieden uns für das Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee. Dort führte uns bereits am 21.06.2025 eine öffentliche Wanderung hin, bei der das Pilzaufkommen noch sehr zu wünschen übrig ließ. Die Teilnehmer gingen damals zwar auch mit gut gefüllten Speisekörben nach Hause – aber die Artenvielfalt war im Frühsommer erwartungsgemäß noch nicht so hoch.
Eine gute Gelegenheit, um heute nachzusehen, wie sich nach fast 2 Monaten das Pilzwachstum so verändert hat.
Den vollständigen Bericht findet ihr hier.
Catrin
14.08.2025 – Donnerstag

Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) mit der hier sehr gut sichtbaren sackartíg umhüllten knolligen Stielbasis.
Foto: Julia Richardt
Nicht nur wir hatten gestern Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) gefunden – sie sind derzeit fast überall in Wäldern, Parks und Gärten zu finden. Es ist der wichtigste Pilz, den jeder Pilzsammler unbedingt kennen muss. Deswegen stellen wir ihn hier noch einmal genau vor.
Die meisten tödlichen Pilzvergiftungen gehen auf den Grünen Knollenblätterpilz zurück – schon der Verzehr von 50 Gramm eines Pilzfruchtkörpers kann tödlich enden. Denn die darin enthaltenen lebergiftigen Amatoxine verursachen ohne medizinische Versorgung ein mehrfaches Organversagen.
Meist wird der Grüne Knollenblätterpilz mit essbaren Champignons oder grünen Täublingen verwechselt. Durch die freien, weißen Lamellen unter dem Hut und die sackartig umhüllte, knollige Stielbasis ist der Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) aber gut zu erkennen. Doch die Basis kann in der Streu verborgen sein, weshalb man unbekannte und ähnliche Lamellenpilze aus dem Boden hebeln sollte, statt sie abzuschneiden.
Wenn ihr euch bei euren Funden nicht sicher seid – geht zu einem Pilzberater oder Pilzsachverständigen und lasst eure Funde überprüfen.
Catrin

Grüne Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) in verschiedenen Altersstadien am 13.08.2025.
Foto: Julia Richardt

Diese beiden Pilze wuchsen nur etwa 30 cm voneinander entfernt. 13.08.2025
Links: Der essbare gilbende Schiefknollige Anis-Champignon (Agaricus essettei)
Rechts: Der tödlich giftige Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides)
Foto: Hanjo Herbort

Auch der beliebte Frauen-Täubling (Russula cyanoxantha) kann bei seiner Farbvielfalt mit einem grüngefärbten Hut erscheinen. 13.08.2025
Foto: Julia Richardt

Bei Birken finden wir häufig den Grasgrünen Täubling (Russula aeruginea) – ebenfalls ein Speisepilz. 12.08.2025
Foto: Catrin Berseck
15.08.2025 – Freitag

Strubbelkopfröhrling (Strobilomyces strobilaceus) am 12.08.2025. Markant sind die sehr weichen, dunkelgrauen bis schwarzen, pyramidenförmigen bzw. aufgerichteten schuppenartigen Strukturen auf der sonst graubräunlichen bis fast weißen Hutoberfläche.
Foto: Martina Simmerl
Mittlerweile haben wir seit fast 2 Wochen hochsommerlichen Temperaturen ohne nennenswerte Niederschläge. Reinhold hat das immer als „August-Depression“ bezeichnet. Laut Reinhold ist das eine immer wiederkehrende Phase im August, in der auf Grund von hochsommerlicher Hitze und Trockenheit kaum Frischpilze zu finden sind.
Und wie ich heute feststellen musste, befinden wir uns derzeit genau in dieser Phase. Fast alle Pilze, die ich auf meiner heutigen Tour gesehen habe, hatten massive Trockenschäden. Frisch gewachsene Pilze waren kaum zu sehen.
Aber kein Grund für uns Pilzsammler auch depressiv zu werden. Ab Mitte nächster Woche sind bereits leichte Niederschläge angekündigt und die Hauptsaison beginnt ja auch erst im September – sofern wir bis dahin ausreichend mit Regen bedacht werden.
Hier ein paar Funde von dieser Woche und heute.
Catrin

Die ersten Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis) – auch mit leichten Trockenschäden am 12.08.2025.
Foto: Catrin Berseck

Wie der Name schon vermuten lässt – der Riesenporling (Meripilus giganteus) kann bis 50 – in Ausnahmen auch bis zu 100 cm breit und bis zu 70 kg schwer werden. Damit bildet er in Mitteleuropa die größten und schwersten Sammelfruchtkörper.
Foto: Catrin Berseck
16.08.2025 – Sonnabend

Anhängsel-Röhrling (Butyriboletus appendiculatus) – auch Laubwald-Anhängselröhrling genannt, da er im kalkreichen Buchenwald vorkommt.
Foto: Catrin Berseck
Heute habe ich nach der Arbeit mal ein Waldstück in meiner näheren Umgebung aufgesucht, wo ich längere Zeit nicht mehr war.
Außer massenweise bereits überständige Sommer- als auch Gemeine Steinpilze war das Artenaufkommen wie erwartet sehr reduziert. Ein paar Täublinge und Grüne sowie Gelbe Knollenblätterpilze habe ich noch gesehen.
Umso mehr habe ich mich gefreut, den seltenen Anhängselröhrling (Butyriboletus appendiculatus) zu finden. Er wird auch Gelber Bronze-Röhrling oder Gelber Steinpilz genannt und ist eine sehr selten gewordene Pilzart aus der Familie Dickröhrlingsverwandten.
Er ist in der Roten Liste gefährdeter Pilze Deutschlands in Stufe 3 als gefährdet eingestuft. Damit versteht es sich von selbst, dass dieser eigentlich essbare Pilz nicht zu Speisezwecken gesammelt werden darf.
Catrin

Besonders gut ist hier die leuchtend gelben Poren und der scharfe Hutrand sowie die überstehende Huthaut zu sehen.
Foto: Catrin Berseck

Der Anhängselröhrling (Boletus appendiculatis) blaut im Gegensatz zum Falschen Anhängselröhrling (Boletus subappendiculatis), der im sauren Nadelwald wächst.
Foto: Catrin Berseck
17.08.2025 – Sonntag
Die von Reinhold beschriebene August-Depression zeigte sich gestern in einem östlich gelegenen und mir bis dato unbekannten Buchenwald in voller Ausprägung – kaum frische Fruchtkörper und viele Mumien von Steinpilzen und vor allem Hexenröhrlingen. Hier und da gab es mal ein paar frische Täublinge verschiedener Arten oder Perlpilze, jedoch auch die fast alle mit Trockenschäden. Soweit ich das überprüft habe zudem oft völlig vermadet.
Es ging mir aber nicht vornehmlich darum, Pilze zu finden. Ich begehe immer mal wieder neue Wälder, um mir einen Eindruck zu machen und meine Auswahl an geeigneten Revieren zu erweitern.
Daher war ich dann heute mit nur wenigen Erwartungen wieder in „meinem“ Forst unterwegs – eher um mich zu entspannen, als Pilze zu finden. Aber hier sah es ganz anders aus als gestern. Pilze auf Schritt und Tritt – sowohl überständige aus der Hitze, als auch ganz junge und frische Fruchtkörper.
So mutierte der geplante Spaziergang dann doch wieder unerwartet zu einer Sammeltour und endete mit einem Misch-Pilzgericht aus diversen Arten bei meinem Bruder zum Grillabend. Welch ein schöner Sonntag durch die Pilze – völlig unerwartet.
Nachfolgend ein paar Arten aus der Misch-Pilzpfanne.
Hanjo

Grüngefelderter Täubling (Russula virescens) – einer der besten Speisepilze unter den Täublingen.
Foto: Hanjo Herbort

Ebenfalls eine sehr guter Speisepilz unter den Täublingen ist der Frauentäubling (Russula cyanoxantha).
Foto: Hanjo Herbort
18.08.2025 – Montag

Kegelhütiger oder Spitzhütiger Knollenblätterpilz (Amanita virosa). Der weiße Stiel ist beflockt, im Jungstadium häufig schuppig-faserig strukturiert. Die zwiebelartig verdickte Stielbasis steckt in einer eng anliegenden Scheide.
Foto: Catrin Berseck
Aufgrund der sommerlichen Temperaturen ist das Frischpilzaufkommen etwas zurück gegangen. Es lohnt sich jetzt aber wieder nach Lungenseitlingen (Pleurotus pulmonarius) Ausschau zu halten – die sind gerade überall vorwiegend an Totholz von Buchen zu finden. Auch die kaum zu übersehenden Riesenporlinge (Meripilus giganteus) haben gerade ihren großen Auftritt.
Momentan sind auch überall die tödlich giftigen Knollenblätterpilze zu finden. Sowohl Hanjo als auch ich haben die Grünen Knollenblätterpilze (Amanita phalloides) am Wochenende überall gesehen. Man kann diesen Pilz nicht oft genug zeigen und vor ihm warnen – jeder Pilzsammler sollte ihn in allen seinen Entwicklungsstadien, Formen und Farben kennen und erkennen. Deswegen zeigen wir sie hier auch noch einmal.
Genauso tödlich giftig – wenn auch seltener zu finden – ist der Kegelhütige oder Spitzhütige Knollenblätterpilz (Amanita virosa). Er kommt in der Regel vor allem in feuchten Nadelwäldern, durchaus aber auch im Laubwald vor.
Der Hut des Kegelhütigen Knollenblätterpilzes ist beim jungen Fruchtkörper spitzkegelig, später mehr oder weniger ausgebreitet, aber immer etwas kegelig bleibend, wovon sich auch die deutsche Bezeichnung ableitet. Im Gegensatz zum Grünen Knollenblätterpilz steckt die zwiebelartig verdickte Stielbasis in einer eng anliegenden Scheide.
Der Kegelhütige Knollenblätterpilz kann unter den Speisepilzen vor allem im Jungstadium mit weißen Champignons verwechselt werden – hat aber weiße Lamellen.
Catrin

Hier handelt es sich nicht etwa um ein essbares Hexenei einer Stinkmorchel. Es ist ein ganz junger Grüner Knollenblätterpilz (Amanita phalloides), der gerade aus seiner Gesamthülle (Velum universale) herausbricht.
Foto: Hanjo Herbort

Von den weißen Velumresten bleiben beim weiteren Wachstum selten häutige Reste auf der Hutoberfläche zurück – lediglich am Stielgrund bleibt eine häutig-lappig hochstehende Volva stehen. Der Stiel ist auf weißem Grund blass olivgrün genattert.
Foto: Hanjo Herbort
19.08.2025 – Dienstag
Der Trockenheit trotzen derzeit nur die Baumpilze. Schmetterlingstrameten und auch die von oben ähnlich aussehenden Birkenblättlinge (die haben aber Lamellen anstatt einer Porenschicht) sind nicht auf Regen angewiesen. Die Fruchtkörper erscheinen ganzjährig an liegendem Laubholz oder an Laubbaumstümpfen.
Wo wir schon mal bei den Schmetterlingen sind – das ist artenreichste Insekten-Ordnung nach den Käfern. Sie werden in Tag- und Nachtfalter unterschieden.
Unser Naturfreund Chris widmet sich bereits seit Jahren der Kartierung (also Erfassung) der Nachtfalter. Die Artenvielfalt ist in den letzten Jahren drastisch zurück gegangen, so dass eine Erfassung der noch vorhandenen Arten wichtig ist.
Der Rückgang der biologischen Vielfalt – damit auch der Falter – hat sich dramatisch beschleunigt, was hauptsächlich auf die Aktivitäten des Menschen zurückzuführen ist. Landnutzungsänderungen, Verschmutzung und Klimawandel bedrohen die Biodiversität auf unserer Erde.
Bei günstigen nächtlichen Temperaturen können einige Arten der Nachttfalter noch bis Ende September angetroffen und kartiert werden. Falls ihr Interesse daran habt und Chris unterstützen möchtet – in diesem Beitrag erfahrt ihr Näheres dazu.
Catrin

Die im Volksmund als „Motten“ bezeichneten Nachtfalter können wie die Tagfalter auch sehr schön sein. Hier das Rosen-Flechtenbärchen (Miltochrista miniata).
Foto: Christopher Engelhardt
24.08.2025 – Sonntag
Die Pilze machen gerade etwas Pause beim Wachstum – deswegen hat das Tagebuch auch mal eine kurze Pause eingelegt…

Ein wenig für die Pfanne gab es auf der heutigen kurzen Pilzrunde trotz Trockenheit dennoch.
Foto: Hanjo Herbort
Heute hatte ich nur wenig Zeit, aber eine kurze Sonntagsrunde auf „meiner“ Seite des mit Catrin geteilten Buchenwaldes musste einfach drin sein.
Also wanderte ich über Mittag eine mir gut bekannte Strecke ab und musste feststellen, dass die propagierte August-Depression nun auch hier mehr oder weniger eingesetzt hat. Hier und da ließen sich jedoch noch ein paar Fruchtkörper finden, so dass auch diese Runde nicht von Langeweile geprägt war, wobei das im Wald Gott sei Dank selbst bei völliger Flaute nie mein Gefühl ist.
So hatte ich nach einer Dreiviertelstunde doch wieder so einiges im Körbchen und als Foto in meinem Handy gespeichert. Sonst sind den Pilzen die niedrigen Werte bei der Luftfeuchtigkeit und der Wind meist stark anzusehen. Nur die ganz frischen waren durchaus ansehnlich, wenn auch weit gestreut im Moment.
Der spannendste Fund waren heute ein paar große beringte Flämmlinge an einem morschen Stamm.
Hanjo

Der Beringte oder Prächtige Flämmling (Gymnopilus junonius) ist ein Saprobiont und wächst meist in großen Büscheln fast ausschließlich auf Laubholzstümpfen, sehr selten auf Nadelholz.
Foto: Hanjo Herbort

Von der Trockenheit gezeichnete Gemeine Stockschwämmchen (Kuehneromyces mutabilis).
Foto: Hanjo Herbort

Ein wichtiges Merkmal sind die abstehenden Schüppchen auf gelbweißem Grund. Oberhalb des Rings ist der Stiel hellgelb und glatt, zur Basis dunkler braun.
Foto: Hanjo Herbort
27.08.2025 – Mittwoch
Heute fand unsere Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Zurow statt. Wir hatten uns im Vorfeld ein Waldgebiet zwischen Schimm und Moltow ausgesucht.
6 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. trafen sich um 16 Uhr in Schimm. Von dort ging es einen von verschiedenen Bäumen und Sträuchern gesäumten Weg an Feldern und Weideflächen vorbei in Richtung Wald. Gleich zu Beginn begrüßte uns ein schöner Buchenabschnitt – es gab aber auch moorige Birkenbereiche sowie Fichtenabschnitte.
Trotz der Trockenheit und allgemein vorherrschenden Pilzarmut konnten wir einiges in unsere Kartierungsdatei aufnehmen und hatten mal wieder eine schöne Wanderung.
Einen ausführlicheren Bericht inklusive der Fundliste findet ihr hier.
30.08.2025 – Sonnabend

Ein einsamer Mehlräsling (Clitopilus prunulus) allein auf weiter Flur… Von den Steinpilzen, die er anzeigen soll, ist weit und breit nichts zu sehen.
Foto: Hanjo Herbort
Heute hätte der Sammelkorb auch zu Hause oder im Auto bleiben können.
Im nahegelegenen Kalkbuchenwald herrschte auf meiner Runde mächtig Flaute aus Sicht der Speisepilz-Sammler – oder wie Reinhold sie gerne bezeichnete: Mykophagen. Ich fand auf meiner knapp 3 km langen Runde nicht einen Täubling oder Röhrling. Die wenigen Pilze, die wuchsen, waren für mich als Foto-Objekt natürlich trotzdem interessant und es war eine schöne Runde.
Hauptsächlich auf Holz zeigten sich noch einige Pilzarten und thronen auf ihren Substraten.
Der Mykophage in mir weiß nun aber – die nächsten Besuche werden nicht den Buchenwäldern gelten, sondern in den umliegenden Kiefernwäldern stattfinden. Denn Krause Glucken sind ebenfalls Holzbewohner, auch wenn sie meist neben den Wirtsbäumen aus dem Boden zu kommen scheinen. Sie sind nun das Objekt der Begierde und die Zeit ist ran, um nach ihnen zu suchen. Sollte sich Erfolg einstellen, wird hier sicher davon zu lesen sein.
Hanjo

Der Hut ist jung lila bis weinrot gefärbt und blasst im Alter ockerfarben aus. Der Hutrand ist anfangs eingerollt, später glatt und scharf.
Foto: Hanjo Herbort

Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum) teilen sich den Stubben mit einem hübschen orangenem Schleimpilz.
Foto: Hanjo Herbort
26.07.2025 – MTB 1836/1+2 Kühlungsborn
Kartierungsexkursion
Messtischblatt Kühlungsborn
26. Juli 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 1836/1+2 Kühlungsborn
Unsere heutige Kartierungsexkursion führte uns in das Messtischblatt 1836 Kühlungsborn – und das auch nicht wie üblich an einem Mittwoch, sondern an einem Sonnabend. Grund dafür war, dass uns für die ersten beiden Quadranten dieses MTB als Exkursionsgebiete nur Teile des Strandbereiches sowie der nördliche Teil des Kühlungsborner Stadtwaldes zur Verfügung standen, da der überwiegende nördliche Teil der beiden Quadranten in der Ostsee liegt.
Also beschlossen wir kurzerhand, die Kartierung des 1. und 2. Quadranten als Ganztagsexkursion auf einen Sonnabend zu legen. Wir, das waren 5 Mitglieder der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V.
Wir trafen uns südlich des Kühlungsborner Stadtwaldes auf einem der wenigen kostenfreien Parkplätze. Schon auf dem Weg zum Stadtwald sahen wir viele Kleinpilze auf Rasenflächen. Dazu gehörten Tintlinge, Faserlinge, Ackerlinge, Samthäubchen und Nelkenschwindlinge.
Dann erreichten wir den Stadtwald und gingen erst einmal ein Stück auf den gut ausgebauten Wanderwegen Richtung Nordosten – wir begannen mit dem kleineren 2. Quadranten und gingen dann westlich in den 1. Quadranten. Zum Mittag erreichten wir die Strandpromende, suchten uns ein wenig abseits von dort eine Pizzeria und gingen dann im westlichen 1. Quadranten wieder zurück zu unseren geparkten Autos.
Der Kühlungsborner Stadtwald ist ein Mischwald mit vorwiegend Kiefern, Stieleichen, Rotbuchen, Birken, Lärchen und Ahorn. Teilweise sehr viel Unterholz und verkrautet – einige lichte Eichen- oder Rotbuchenabschnitte gibt es auch. Er wird auch forstwirtschaftlich genutzt, wie uns das zum Abtransport gestapelte Holz an den Wegrändern zeigte.
Frischpilze hielten sich heute noch mächtig zurück – trotzdem konnten wir ein paar schöne Funde verzeichnen.
Mit unserer Fotodokumentation möchten wir euch wieder ein paar Eindrücke von dieser Exkursion vermitteln.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Auf geht´s vom Parkplatz in den Kühlungsborner Stadtwald, der bereits im Hintergrund zu sehen ist. Natürlich haben wir uns auf dem Weg dorthin auch die Pilze außerhalb unseres Kartierungsgebietes angesehen – auch auf dieser gemähten Rasenfläche.
Foto: Sylvina Zander

Nicht näher bestimmte Vertreter der Samthäubchen (Conocybe sp.) – eine Pilzgattung aus der Familie der Mistpilzverwandten. Diese Gattung umfasst ca. 150 Arten.
Foto: Angeli Jänichen

Weißer Ackerling (Agrocybe dura). Das Velum bleibt meistens in Form häutiger Fetzen am Hutrand hängen bzw. befindet sich als flüchtige Ringzone dicht unter dem Hut.
Foto: Angeli Jänichen

In Moospolstern findet man oft Orangerote Heftelnabelinge (Rickenella fibula). Die kleinen, zierlichen Fruchtkörper haben einen tief genabelten und oft lebhaft orange gefärbten Hut. Die deutlich blasser gefärbten Lamellen auf der Unterseite laufen weit an dem dünnen Stiel herab.
Foto: Angeli Jänichen

Jens war heute unser Navigator. Ohne ihn hätten wir wahrscheinlich mehrfach unser Kartierungsgebiet in dem weitläufigen Waldgelände versehentlich verlassen.
Foto: Angeli Jänichen

Wir haben den als Denkmal aufgestellten Friedensstein oder Bismarckstein erreicht. 1908 wurde dieser Findling dem Gedenken an Reichskanzler Otto von Bismarck zu Ehren aufgestellt und der Schriftzug BISMARCK eingearbeitet. In der damaligen DDR wurde 1952 dieser Schriftzug entfernt und mit der Inschrift FRIEDENSSTEIN ersetzt.
Foto: Angeli Jänichen

Es waren ältere Exemplare der derzeit überall zu findenden Brennenden Rüblinge (Gymnopus peronatus). Der Pilz ist saprotroph, ernährt sich also von verrottendem Pflanzenmaterial.
Foto: Angeli Jänichen

Langstielige Ahorn-Holzkeulen (Xylaria longipes) fressen sich langsam mit ihrem Myzel durch totes Holz und hinterlassen eine wunderbare Maserung, die mit dem Muster an ein Giraffe erinnert und deshalb auch Giraffenholz genannt wird.
Foto: Angeli Jänichen

Brandkrustenpilz (Kretzchmaria deusta). Der Brandkrustenpilz besitzt ein krustenförmiges, ausgedehntes schwarzweißes Stroma und einer unregelmäßigen Begrenzung. Die Konsistenz ist sehr hart, im Alter fühlt sich das Gebilde wie Holzkohle an.
Foto: Angeli Jänichen

Der vermutlich häufigste Schleimpilz weltweit – Geweihförmiger Schleimpilz (Ceratiomyxa fruticulosa).
Foto: Angeli Jänichen

Der Pilz ist farblos und transparent, die weiße Farbe entsteht durch die an der Oberfläche gebildeten Sporen.
Foto: Angeli Jänichen

Eine andere Variation des Geweihförmigen Schleimpilzes – das Weiße Netzpolster (Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides).
Foto: Angeli Jänichen

Ein weiterer Vertreter der Schleimpilze: Der Lachsfarbene Schleimpilz (Tubifera ferruginosa) – wegen seines Aussehens auch Fischeierschleimpilz genannt.
Foto: Angeli Jänichen

Klebriger Hörnling (Calocera viscosa) – auch auch Ziegenbart oder Zwergerlfeuer genannt.
Foto: Angeli Jänichen

Grubiger oder Schleimiger Wurzelrübling (Xerula radicata) mit seinem wurzelnden Stiel.
Foto: Angeli Jänichen

Am Stamm einer Buche fanden wir dann diesen noch kleinen jungen Riesenporling (Meripilus giganteus). Jung ist er gelbbraun bis zimtfuchsig, dann dunkelbraun mit cremegelblichem Rand. Alt und verletzt schwärzt er – was man bereits an den Fraßstellen sehen kann.
Foto: Angeli Jänichen

Der Gemeine Violettporling (Trichaptum abietinum) wächst an toten Ästen und Stämmen verschiedener Nadelbäume. Die dünnen, lederig-zähen Hütchen sind meist dachziegelartig übereinander oder seitlich verwachsen. Die weißlich-graue Oberseite ist filzig behaart und konzentrisch gezont.
Foto: Angeli Jänichen

Wulstige Lackporlinge (Ganoderma adspersum). Seine Oberfläche ist wellig-höckerig und mit einer harten, nicht eindrückbaren Kruste bedeckt. Damit unterscheidet er sich auch unter anderem vom Flachen Lackporling.
Foto: Angeli Jänichen

Konsolenförmige und treppenartig miteinander verbundene junge Eichenwirrlinge (Daedalea quercina).
Foto: Angeli Jänichen

Ein Rotbrauner bzw. Fuchsiger Scheidenstreifling (Amanita fulva) kämpft sich aus dem Laub hervor.
Foto: Angeli Jänichen

In einem lichten Buchenbereich verneigte sich dann dieser betagte Gemeine Steinpilz (Boletus edulis) vor uns.
Foto: Angeli Jänichen

Der Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus) infiziert Röhrenpilze, zunächst mit einer dünnen weißlichen Schicht aus Hyphen, die später durch die Sporenmasse goldgelb wird.
Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Weg zur Uferpromenade erregte dieser Stein unsere Aufmerksamkeit. Ein aus dem Mittelalter stammender Rohling einer Mordwange, auch Mord- oder Sühnestein genannt.
Foto: Angeli Jänichen

Wir gingen ein wenig in die Stadt hinein und suchten uns etwas abseits eine ruhige Pizzeria für unsere Mittagspause aus.
Foto: Angeli Jänichen

Auch in der Stadt gibt es Pilze – so wie hier der Stadtchampignons (Agaricus bitorquis) am Gehwegrand.
Foto: Angeli Jänichen

Gesäte Tintlinge (Coprinellus disseminatus) in der Stadt auf einem Rasengrundstück.
Foto: Angeli Jänichen

Nach der Pizza gönnten wir uns alle noch ein Eis und beobachteten das Treiben auf der Strandpromenade.
Foto: Angeli Jänichen

Auf dem Rückweg kamen wir dann am Ententeich vorbei. Aber nicht nur viele Enten gab es dort zu sehen – wir entdeckten auch seltene und geschützte Orchideen.
Foto: Angeli Jänichen

Es handelt sich um die Breitblättrige Stendelwurz (Epipactis Helleborine), die noch weitgehend ungefährdet ist, aber ein Rückgang der Vorkommen feststellbar ist.
Foto: Angeli Jänichen

Dünnschaliger Kartoffenbovist (Scleroderma verrucosum). Jung ist er im Anschnitt gelblich und bildet später grauschwarzes Pulver.
Foto: Angeli Jänichen

Ein bereits innen schwarz gefärbter Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum).
Foto: Angeli Jänichen

Im Nadelwaldbereich fanden wir Massen an Samtfuß-Holzkremplingen (Tapilnella atromentosa). Hier mal ein schönes Exemplar im Bild festgehalten.
Foto: Angeli Jänichen

Diese kleinen Pilze bereiteten uns anfangs wegen des gelben Hutes und dem von Jedem anders wahrgenommen Geruch etwas Kopfzerbrechen.
Foto: Angeli Jänichen

Zum Glück war auch noch ein etwas älteres lädiertes Exemplar vorhanden. Es handelt sich um stärker gilbende Champignons aus der Sektion Arvensis. Das sind die nach Anis, Bittermandel oder Weihnachtsplätzchen riechenden Champignons. Schiefknollige Anisegerlinge (Agaricus essettei).
Foto: Angeli Jänichen

Eine schöne Exkursion geht zu Ende – auf dem Weg zurück zu unseren geparkten Autos.
Foto: Angeli Jänichen

Am Abend nahmen Dirk, Dorit, Sylvina und ich noch einen Abschiedstrunk am Kröpeliner Stadtholz.
Foto: Catrin Berseck
Die Artenliste aus dem Kühlungsborner Stadtwald – MTB 1836/144 NW:
Stadtchampignon (Agaricus bitorquis), Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva), Perlpilz (Amanita rubescens), Gemeiner Steinpilz (Boletus edulis), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Geweihförmiger Schleimpilz (Ceratiomyxa fruticulosa), WEißer Netzpolster (Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides), Gesäter Tintling (Copprinellus disseminatus), Eichen-Wirrling (Daedalea quercina), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alte KK (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Wulstiger Lackporling (Ganoderma adspersum), Gemeiner Waldfreund-Rübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus personatus), Gemeiner Wurzelschwamm (Hetereobasidion annosum), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hypoxylon cohaerens), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Kiefernnadel-Spaltlippe (Lophodermium pinastri), Blutmilchpilz (Lycogala epedendrum), Nelken-Schwindling (Marasmius oreades), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Riesenporling (Meripilus giganteus), Frauen-Täubling (Russula cyanoxanthas), Dickblättriger Schwärztäubling – alte FK (Russula nigricans), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Dünnschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma verrusosum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Samtfußkrempling (Tapinella atromentosa), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Lachsfarbener Schleimpilz (Tubifera ferruginosa), Wurzelnder Schleimrübling (Xerula radicata)
Die Artenliste aus dem Kühlungsborner Stadtwald – MTB 1836/233 NO:
Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Geweihförmiger Schleimpilz (Ceratiomyxa fruticulosa), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Gemeiner Waldfreund-Rübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus personatus), Gemeiner Wurzelschwamm (Hetereobasidion annosum), Goldschimmel (Hypomyces chrysospermus), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Kiefernnadel-Spaltlippe (Lophodermium pinastri), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Lila Rettichhelmling (Mycena pura), Dickschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma citrinum), Dünnschaliger Kartoffelbovist (Scleroderma verrusosum), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Gemeiner Violettporling (Trichaptum abietinum), Langstielige Ahornholzkeule (Xylaria longpipes)
19.07.2025 – Öffentliche Wanderung bei Dabel/Turloff
Öffentliche Pilzlehrwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
19. Juli 2025 – Im ehemaligen Staatsforst Turloff
Die heutige Pilzlehrwanderung führte in die Nähe von Dabel – in die Wälder um den ehemaligen Forsthof Turloff. Bei angesagten hochsommerlichen Temperaturen von 30 Grad kamen Jens und Katarina zum vereinbarten Treffpunkt.
Laub- und Nadelforste sowie heideartiges Gelände zeichnen die vielseitige Wanderroute aus. Ich hatte das Gebiet im Vorfeld ausgesucht, da auf den sauren sandigen Böden zu dieser Zeit mit Pfifferlingen, Täublingen und Wulstlingen zu rechnen war. Dementsprechend hatte ich für die Terminankündigung auch ein Foto mit Pfifferlingen ausgewählt.
Die Artenvielfalt war der vorherigen Trockenheit geschuldet etwas bescheiden – aber die vielen Pfifferlinge, die wir in den dicken Moospolstern und im Laub fanden – hätten das Herz eines jeden Speisepilzsammlers höher schlagen lassen! Wir hatten nach kurzer Zeit genug von den gelben Eierschwämmen für unseren Eigenbedarf gesammelt und haben uns auf dem Rückweg noch nicht mal mehr nach ihnen umgesehen… Es gibt für Pfifferlinge, Steinpilze und Co. sowieso eine Sammelbeschränkung: 2 kg pro Person und Tag sind erlaubt.
Und es gab noch etwas, worüber ich mich besonders gefreut habe. Jens konnte fast alle der gestern neu gelernten Pilze heute wieder erkennen und richtig bestimmen. Ob private oder öffentliche Wanderung – es handelt sich ja um Lehrwanderungen, bei denen man sein Wissen über Pilze erweitern will und soll.
Falls ihr auch wie Jens mehr über Pilze lernen und einige neue Arten in euren Gesichtskreis aufnehmen wollt, nehmt doch einfach mal an einer Pilzwanderung teil. Schaut regelmäßig unter Termine 2025 nach. Die Termine für die Öffentlichen Wanderungen werden teilweise kurzfristig (1 bis 3 Wochen vor dem Termin) bekannt gegeben, da das Pilzwachstum witterungsabhängig ist.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich zu Beginn unserer Wanderung fanden wir im Buchenlaub einige wenige Pfifferlinge. Die Einheimischen kennen diese Stelle auf dem Buchenberg natürlich, so dass dort schon weitestgehend abgeernet war. Trotzdem ein hoffnungsvoller Auftakt!
Foto: Catrin Berseck

Wie gestern auch, waren Fleischrote Speisetäublinge (Russula vesca) hier auch vertreten.
Foto: Catrin Berseck

Auch junge Samtfußkremplinge (Tapinella atrotomentosa) waren auf dem Buchenberg zu finden.
Foto: Catrin Berseck

Nach dem Buchenberg erreichten wir eine offene Heidelandschaft mit Kiefern, Birken und viel Heidekraut. Der Kleinstrauch zählt zu den säureliebenden Pflanzen und bevorzugt nährstoffarme, durchlässige Sandböden und ist somit ein zuverlässiger Bodenanzeiger.
Foto: Catrin Berseck

Eine extrem schmächtiger und untypischer Narzissengelber Wulstling (Amanita gemmata).
Foto: Catrin Berseck

Der Rehbraune Dachpilz (Pluteus cervinus agg.) ist der mit Abstand häufigste Vertreter seiner Gattung und besiedelt sowohl Laub- als auch Nadelhölzer.
Foto: Catrin Berseck

Diese Rehbraunen Dachpilze wachsen nicht auf dem Boden, sondern an vergrabenen Holzresten.
Foto: Catrin Berseck

Kurze Verschnaufpause. Im Schatten der Bäume war von der brütenden Hitze zum Glück nicht so viel zu merken. Aber die kleinen Insekten nervten.
Foto: Catrin Berseck

Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanta fulva). Meist sind dort dann auch Pfifferlinge zu finden…
Foto: Catrin Berseck

Und da waren Sie dann auch – die Pfifferlinge! Schon vom Wegrand aus war das leuchtende Gelb zu sehen! Wir mussten gar nicht lange suchen, um unsere Mahlzeiten zu sammeln.
Foto: Catrin Berseck

Am Wegrand auf dem Rückweg dann ein Parasol bzw. Riesenschirmpilz (Macrolepiota procera) – zu erkennen an seinem genatterten Stiel und dem doppelten Ring.
Foto: Catrin Berseck

Auch dieser Perlpilz (Amanita rubescens) war als Vertreter der Wulstlinge anwesend.
Foto: Catrin Berseck

Auf dem Rückweg zu unseren Autos am kalkhaltigen Straßenrand fanden wir dann noch einige Täublinge. Hier sehen wir den Braunen Ledertäubling (Russula integra).
Foto: Catrin Berseck
Die Artenliste im ehemaligen Staatsforst Turloff – MTB 2337/134:
Narzissengelber Wulstling (Amanita gemmata), Perlpilz (Amanita rubescens), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Gemeiner Waldfreundrübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus peronatue), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Orangeroter Heftelnabeling (Rickenella fibula), Fleischroter Speisetäubling (Russula vesca), Samtfußkrempling (Tapinella atromentosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Grubiger Wurzelrübling (Xerula radicata)
Die Artenliste im ehemaligen Staatsforst Turloff – MTB 2337/312:
Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanta fulva), Perlpilz (Amanita rubescens), Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius), Gebänderter Dauerporling (Coltricia perennis), Blutmilchpilz (Lycogla epidendrum), Parasol (Macrolepiota procera), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum)
18.07.2025 – Private Wanderung in der Schwinzer Heide
Private Pilzwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
18. Juli 2025 – In der Schwinzer Heide
Unser Vereinsmitglied Jens aus Berlin „flüchtet“ öfter mal am Wochenende aus der Großstadt in die Natur. Für dieses Wochenende hatte er sich eine Unterkunft am Rande der Schwinzer Heide gebucht und sich auch zu unserer Öffentlichen Wanderung am Sonnabend angemeldet.
Kurzfristig haben wir uns dann am späten Nachmittag in der Schwinzer Heide zu Dritt verabredet. Corina – Pilzberaterin aus Torgelow am See – kam mit dazu. Wir wollten uns über das Pilzwachstum vor Ort informieren und Speisepilze sammeln. Jens wollte hauptsächlich neue Pilzarten lernen.
Treffpunkt war der Waldfriedhof im kleinen Ort Glave. Dort besuchten wir erst einmal den Gutspark bevor es dann eine kurze Runde durch die sauren hauptsächlich aus Kiefern, Birken und teilweise Eichen bestehenden Waldbereiche gab. Anschließend fuhren wir noch ein Stück weiter und gingen in einen Jungeichenwald mit anschließendem Birkenwald.
Es war eine sehr schöne Wanderung mit einigen schönen Funden und reicher Ausbeute an Speisepilzen.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Die Gelb-Kiefern (Pinus ponderosa) im Gutspark Glave – eigentlich im Westen Nordamerikas beheimet und Namensgeber der „Ponderosa-Ranch“ aus der Fernsehserie Bonanza.
Foto: Jens Hegewald

Die dicke Borke der Gelb-Kiefer ist stark gefurcht und hat glatte, gelblich bis rötlich-braune sowie rosa getönte Platten.
Foto: Jens Hegewald

Am Fuße einer alten Stiel-Eiche im Park dann mehrere Büschel Spindeliger Rüblinge (Gymnopus fusipes). Merkmal sind die spindelig wurzelnden, oft verdrehten und längsfurchigen Stiele sowie rostbraune Flecken an Hut, Lamellen und Stiel.
Foto: Catrin Berseck

Ein weiterer Vertreter dieser Gattung ist Brennende Rüblinge (Gymnopus peronatus). Erkennbar am leichten Essiggeruch beim Reiben der Lamellen oder dem brennend scharfen Geschmack.
Foto: Catrin Berseck

Wir gingen weiter in die Kiefernbereiche mit stellenweise eingestreuten Birken. Und da waren sie dann auch endlich – die ersten Echten Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) am heutigen Tag.
Foto: Catrin Berseck

Klebrige Hörnlinge (Calocera viscosa) – auch Ziegenbart oder Zwergerlfeuer genannt.
Foto: Catrin Berseck

Orangerote oder Gemeine Heftelnabelinge (Rickenella fibula). Die kleinen, zierlichen Fruchtkörper haben einen tief genabelten und oft lebhaft orangen Hut. Die deutlich blasser gefärbten Lamellen auf der Unterseite laufen weit an dem dünnen Stiel herab. Der Pilz kommt sowohl in Wiesen, Wäldern als auch in Mooren vor und wächst oft in Moospolstern.
Foto: Catrin Berseck

Gebänderter Dauerporling (Coltricia perennis). Die Art fruktifiziert sehr gerne auf sandigen und trockenem Boden und umwächst Pflanzen – so wie hier diesen Grashalm.
Foto: Catrin Berseck

Wunderschöne junge Samtfußkremplinge (Tapinella atrotomentosa) und im Hintergrund noch eine Gelbe Lohblüte (Fuligo septica).
Foto: Jens Hegewald

Einer der scharfen Speitäublinge (Russula emetica agg.).. Emetica bedeutet Brechreiz erregend – aufgrund der Schärfe kein Speisepilz.
Foto: Catrin Berseck

Gelber Graustiel-Täubling (Russula claroflava). Der Stiel ist bei jungen Exemplaren weiß, nach Berührung rötet er zuerst und wird dann später graufleckig.
Foto: Corina Peronne

Heute gab es massenweise Fleichrote Speisetäubling (Russula vesca) unter Birken und Kiefern.
Foto: Catrin Berseck
Die Artenliste bei Glave – MTB 2439/221:
Riesenchampignon – alter FK (Agaricus augustus), Halbkugelieger Ackerling (Agrocybe pediades), Klebriger Hörnling (Calocera viscosa), Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius), Gebänderter Dauerporling (Coltricis perennsi), Eichen-Wirrling (Dasdalea quercina), Eichen-Mehltau (Erysiphe alphitoides), Eichenfeuerschwamm (Fomitiporia robusta), Gelbe Lohblüte (Fuligo septica), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Gemeiner Waldfreundrübling (Gymnopus dryophilus), Brennender Rübling (Gymnopus peronatue), Spindeliger Rübling (Gymnopus fusipes), Schwefelporling – alte FK (Laetiporus sulphureus), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Nelken-Schwindling (Marasmius oreades), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Sklerotien-Stielporling (Polyporus tuberaster), Behangener Faserling (Psathyrella candolleana), Orangeroter Heftelnabeling (Rickenella fibula), Fleischroter Speisetäubling (Russula vesca), Samtfußkrempling (Tapinella atromentosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor)
Die Artenliste bei Glave – MTB 2439/232:
Echter Pfifferling (Cantharellus cibarius), Fleischroter Speisetäubling (Russula vesca), Gelber Graustieltäubling (Russula claroflava), Rotbrauner Scheidenstreifling (Amanita fulva)
16.07.2025 – MTB 2134/4 Brusenbecker Mühle
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Wismar
16. Juli 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2134/4 – Brusenbecker Mühle

Der Wallensteingraben ist ein Verbindungsgraben zwischen dem Schweriner See und der Ostsee in Wismar. Das naturbelassene Fließgewässer ist teilweise weniger als 50 cm tief. Der Name des Grabens geht auf den Feldherrn Wallenstein zurück, obwohl dieser mit der Planung und dem Bau des Wasserlaufs nichts zu tun hatte – seine ursprüngliche Bezeichnung war die Viechelnsche Fahrt.
Foto: Angeli Jänichen
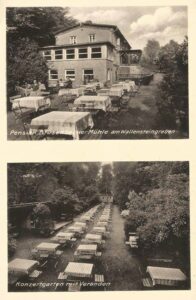
Die Brusenbecker Mühle mit ihrer Pension in den 30-er Jahren – früher ein beliebtes Ausflugsziel am Wallensteingraben.
Quelle: Gemeinde Bad Kleinen
Heute trafen sich 7 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. zu unserer letzten Kartierungsexkursion im Messtischblatt 2134 Wismar. Ausgesucht hatten wir das Gebiet am Wallensteingraben bei der ehemaligen Brusenbecker Mühle nordöstlich von Moidentin bei Fichtenhusen.
Geblieben ist der Wallensteingraben und ein wunderschönes Landschaftsschutzgebiet mit einem gut ausgebauten Wanderweg. Wir waren begeistert von dieser einmaligen Landschaft!
Und wir konnten auch tatsächlich über 30 Pilzarten trotz des immer noch ausgebliebenen Pilzwachstums für unsere Kartierung aufnehmen. Dazu gab es gratis mal wieder von unseren vielseitig interessierten Naturfreunden Wissen über Insekten, Pflanzen und Bäume. Hier wie immer die schönsten Eindrücke von dieser Exkursion in Bild und Text.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Angeli macht unter anderem die schönen Fotos auf unseren Exkursionen. Gut, dass sie Gummistiefel an hat und so auch mal in´s Wasser gehen kann.
Foto: Sylvina Zander

Christian versucht gleich zu Beginn unserer Exkursion am Treffpunkt Schmetterlinge und Libellen im Bild festzuhalten.
Foto: Angeli Jänichen

Chris – unserem Experten u.a. für Insekten – sind dann diese schönen Fotos gelungen: Gebänderte Prachtlibelle (Calopteryx splendens).
Foto: Christopher Engelhardt

C-Falter (Polygonia c-album). Was wir hier jetzt nicht sehen – der Falter hat auf der Unterseite der Flügel eine weiße, C-ähnliche Zeichnung, die dem Falter seinen Namen gab.
Foto: Christopher Engelhardt

Los geht es über die Brücke auf den Wanderweg. Hier sehen wir die Gemeine Hainbuche (Carpinus betulus).
Foto: Christian Boss

Wurzeln einer Rotbuche am Hang. Die Buche ist ein typischer Herzwurzler – es ist eine Mischung aus Tief- und Flachwurzler, wobei die Wurzeln sowohl in die Tiefe als auch in die Breite wachsen. Dieses System bietet eine gute Verankerung im Boden und ermöglicht es dem Baum, Wasser und Nährstoffe sowohl aus der Tiefe als auch aus der Breite zu beziehen.
Foto: Christian Boss

Der erste Frischpilz mit Hut und Stiel muss natürlich von Allen gebührend begrüßt und fotografiert werden.
Foto: Angeli Jänichen

Unsere Aufmerksamkeit erregte ein Wurzelnder Schleimrübling bzw. Grubiger Wurzelrübling (Xerula radicata).
Foto: Angeli Jänichen

Ein junger nicht näher bestimmter kleiner Röhrling aus der Gattung der Filzröhrlinge.
Foto: Angeli Jänichen

Endlich mal ein Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), der seinem Namen alle Ehre macht! In den meisten Fällen ist dieser nämlich gar nicht so ausgeprägt.
Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir mal die Farbvielfalt der Rotrandigen Baumschwämme (Fomitopsis pinicola) und dass nicht alle einen roten Rand haben.
Foto: Angeli Jänichen

Und wo Erlen sind, finden wir meiste auch den Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata) – hier alte Fruchtkörper an Schwarzerle.
Foto: Angeli Jänichen

An einem alten Stamm dann diese Pracht – Gesäte Tintlinge (Coprinus disseminatus) in allen Altersstadien.
Foto: Angeli Jänichen

Eine der Brücken, die über den Wallensteingraben führt. Catrin versucht, Haselnüsse zu pflücken.
Foto: Angeli Jänichen

Eine wunderschöne Sumpf- und Wasserpflanze – der Ästige Igelkolben (Sparganium erectum).
Foto: Christopher Engelhardt

Wir erreichen die Bahnbrücke der Linie Schwerin – Wismar, die direkt über den Wallensteingraben führt.
Foto: Angeli Jänichen

Weiter geht es zurück auf dem Wanderweg entlang der Bahnlinie mit Pilzen auf Totholz. Hier schöne rosa – sogar fast pinke – Blutmilchpilze (Lycogala epidendrum).
Foto: Christian Boss

Man könnte meinen, das diese bereits eintrockneten Halsband-Schwindlinge (Marasmius rotula) sich auf dem Zweig im Tanz wiegen…
Foto: Christian Boss

Auch eingetrocknet sind diese nicht näher bestimmten Stummelfüßchen (Crepidotus sp.).
Foto: Christian Boss

Ein wunderschöner – dieses mal frischer – Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.).
Foto: Christain Boss

Diese beiden aneinander gelehnten Schönheiten sind Vertreter der Helmlinge (links) und Tintlinge (rechts). Die genaue Artbestimmung hätte per Mikroskop erfolgen müssen – deswegen nur das schöne Foto und die Gattungen.
Foto: Christian Boss

Ein kleines Stück Totholz mit ganz schön viel Leben. Das orangene Knopfbecherchen (Orbilia sp.) und Weiße Netzpolster (Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides). Das Weiße Netzpolster ist eine Varietät zum Geweihförmigen Schleimpilz. Unten sehen wir noch weitere weiße kugelförmige Schleimpilze.
Foto: Catrin Berseck

So sah das Stück Holz dann ein paar Tage später aus. Die weißen kugelförmigen Schleimpilze haben sich in schwarze gestielte Fruchtkörper verwandelt.
Foto: Catrin Berseck

Die klitzekleinen mittlerweile schwarzen kugeligen Schleimpilze wunderschön glänzend noch einmal unter der Stereolupe stark vergrößert.
Foto: Catrin Berseck

Katarina wohnt in der Nähe und kennt das Gebiet. Sie hat diese schräg liegende Rotbuche „Kandelaberbaum“ genannt. Die Äste wachsen trotz der Schräglage nach oben, so dass der Wuchs an einen Kerzenleuchter mit Armen erinnert.
Foto: Christian Boss

Hier machten wir auch gleich unser Erinnerungsfoto von dieser schönen Exkursion.
V.l.n.r.: Christian, Katarina, Catrin, Chris, Sylvina und vorne Angeli.
Foto: Angeli Jänichen

Ein junger Kornblumen-Röhrling mit seiner ockerfarbenen, trockenen und grob filzigen Huthaut.
Foto: Catrin Berseck
Nach der offiziellen Kartierungsexkursion bin ich mit Dorit und Sylvina noch in einen in der Nähe liegenden Park gefahren. Die Beiden wollten noch ein paar Speisepilze sammeln.
Gleichzeitig wollten wir auch nachsehen, was dort bereits alles wächst. Und tatsächlich war das Frischpilzaufkommen dort deutlich besser. Perlpilze, Fleischrote Speisetäublinge und ein paar noch sehr kleine Echte Pfifferlinge.
Und zur Krönung zeigten sich dort auch mehrere Exemplare des ziemlich seltenen Kornblumen- Röhrlings (Gyroporus cyanescens). Dorit und Sylvina hatten die noch nie in Natura gesehen und sich wahnsinnig darüber gefreut.
Catrin

Die Röhren des Pilzes sind weißlich bis blassgelblich, der Stiel zitronengelb bis gelbocker.
Foto: Catrin Berseck

Das im Fleisch des Kornblumen-Röhrlings enthaltene Gyrocyanin verursacht die kornblumenblaue Verfärbung bei Luftkontakt. Hier sehen wir eine sehr dunkle Färbung im Artenaggregat. Der Stiel ist arttypisch gekammert.
Foto: Sylvina Zander

Einige der sehr häufig zu findenden Fleischroten Speise-Täublinge (Russula vesca) durften für die Pfanne mit.
Foto: Catrin Berseck
Die Artenliste von der Brusenbecker Mühle – MTB 2134/4:
Riesen-Champignon (Agaricus augustus), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Weißes Netzpolster (Ceratiomyxa fruticulosa var. porioides), Löwengelber Schwarzstielporling (Cerioporus leptocephalus), Gesäter Tintling (Coprinellus disseminatus), Eichenwirrling (Daedales quercina), Eichenmehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomenatarius) Birkenporling (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Gemeiner Waldfreund-Rübling (Gymnopus dryophilus), Gemeiner Wurzelschwamm (Hetereobasidion annosum), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hypoxylon cohaerens), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxylon fuscum), Schiefer Schillerporling (Inonotus obliquus), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Kastanienbrauner Schwarzstielporling (Polyporus badia), Behangener Faserling (Psathyrella candolleana), Hexenkraut-Rost (Puccinia circaeae), Bovistähnlicher Schleimpilz (Reticularia lycoperdon), Dickblättriger Schwärztäubling – alte FK (Russula nigricans), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Bergahorn-Mehltau (Uncinula bicornis), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata), Wurzelnder Schleimrübling (Xerula radicata)
12.07.2025 – Ascomyceten auf Kaninchenwerder
Ascomyceten auf der Insel Kaninchenwerder
bestimmt von Torsten Richter
12. Juli 2025
Wir Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. freuen uns immer, wenn Torsten Richter uns auf unseren Veranstaltungen begleitet.
Torsten ist Biologie- und Chemielehrer und Vorsitzender des Pilzvereins „Heinrich Sternberg“ Rehna e.V.. Seit Jahren beschäftigt er sich mit Pilzen. Dabei haben es ihm besonders die Ascomyceten (Schlauchpilze) angetan – aber auch kleinste Hutträger wecken sein Interesse. Hauptsache schön klein und manchmal mit dem bloßen Auge kaum noch zu erkennen.
Torsten gilt als Experte auf diesem Gebiet unter den Mykologen. Seine wissenschaftlichen Beiträge werden oft in Fachzeitschriften veröffentlicht. Ihm gelangen bereits viele seltene Funde und auch Erstbeschreibungen.
Sein Wissen um diese oft übersehenen und nicht beachteten Kleinstpilze ist immer eine Bereicherung für uns Teilnehmer. Wir möchten deshalb hier einige seiner gefundenen und mikroskopisch bestimmten Ascomyceten von der Insel Kaninchenwerder hier vorstellen und danken auch für die grandiosen Fotos.
Catrin

Scharlachrotes Pustelpilzchen (Neonectria coccinea) an einem bemoosten Stamm von Birne (Pyrus).
Foto: Christian Boss – Bestimmung: Torsten Richter

Typisch für dieses Pustelpilzchens ist, dass die roten Perithezien in dichtgedrängten Büscheln aus der Rinde hervorbrechen und dabei in deren Randbereich sich Rindenteile aufgerichtet haben. Die einzelnen Fruchtkörperchen sind nur 0,2 bis 0,3 mm groß und nur mit einer gut vergrößernden Lupe deutlich sichtbar.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Gras-Kernpilz (Epichloë typhina) an Wald-Zwenke (Brachypodium sylvaticum) am Wegrand.
Foto: Torsten Richter

Bewimperter Schildborstling (Scutellinia crinita) auf morschem Holz. Verschiedenlange Randhaare sind unter anderem ganz typisch für diesen farbenfrohen Pilz.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

So sehen Torstens Funde aus. Für uns ist mit bloßem Auge kaum zu erkennen, dass es sich um Pilze handelt. Aber nachfolgend zeigen wir euch mit Torstens Fotos, wie schön die Kleinstpilze sein können…
Foto: Christian Boss

Ellipsoidsporiges Kurzzellen-Filzgewebe (Tomentella ellisii) auf äußeren Blattscheiden von Sumpf-Segge (Carex acutiformis) im Großseggenried

Septiertsporiges Seggen-Weichbecherchen (Mollisia luctuosa) an Sumpf-Segge (Carex acutiformis).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Gewittergraues Seggen-Weichbecherchen (Mollisia asteroma) an Ufer-Segge (Carex riparia).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Fettes Seggenweichbecherchen (Mollisia pilosa) auf den äußeren Blattschneiden der Ufer-Segge (Carex riparia).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Schimmerndes Weichbecherchen (Mollisia coerulans) an Gewöhnlichem Wasserdost (Eupatorium cannabinum).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Fastgestielter Blattstreu-Kotling (Ascobolus foliicola) auf skelettierten Blattresten auf Schlamm.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Die violettbraunen Sporen in den Asci sind als dunkle Punkte erkennbar.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

„Goldersbach Haarbecherchen“ (Dennisiodiscus goldersbach nom.prov.) an Ufer-Segge (Carex riparia). „nom.prov“: Einen provisorischen Namen, der einem Organismus zugeordnet wird, bevor eine formale, wissenschaftlich gültige Benennung erfolgt, bezeichnet man als nomen provisorium („vorläufiger Name“). Diese werden häufig verwendet, wenn die Klassifizierung eines neuen Fundes noch nicht vollständig gesichert ist, aber dennoch eine vorübergehende Referenz benötigt wird.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Verschiedene Altersstadien von „Goldersbach Haarbecherchen“ (Dennisiodiscus goldersbach nom.prov.).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter
12.07.2025 – Naturexkursion auf der Insel Kaninchenwerder im Schweriner See
Naturexkursion
Insel Kaninchenwerder im Schweriner Innensee
12. Juli 2025
Ein Besuch der Insel Kaninchenwerder im Schweriner See stand schon lange im Fokus. Der erste Termin musste aufgrund von starkem Regen verschoben werden – heute hat es dann endlich geklappt. Von unseren 8 Teilnehmern hatten tatsächlich bisher nur 2 die Insel vorher schon einmal besucht.
Es sollte keine reine Pilzwanderung werden – wir wollten uns neben den Pilzen mit der gesamten Flora und Fauna auf dieser Insel beschäftigen. Als Experte für Ascomyceten war Torsten Richter mit dabei – Chris Engelhardt ließ uns als Naturliebhaber an seinem umfangreichen Wissen zu Insekten teilhaben.
Auf Kaninchenwerder wurde 1561 eine Ziegelei errichtet, die bis 1851 betrieben wurde und mittlerweile abgerissen ist. Durch den Bedarf der Ziegelei an Holz war die Insel danach weitgehend baumfrei. Erst im 19. Jahrhundert wurde Kaninchenwerder wiederaufgeforstet. Dabei wurden auch 60 nicht heimische Gehölzarten angepflanzt.
Die Insel Kaninchenwerder im Schweriner Innensee wurde 1923 Naturschutzgebiet und ist seit 1935 Bestandteil des Naturschutzgebiets Kaninchenwerder und Großer Stein, seit 2005 ist sie Bestandteil des Europäischen Vogelschutzgebietes im Landschaftsschutzgebiet Schweriner Innensee und Ziegelaußensee.
Die Insel ist mittlerweile wieder bewaldet und naturbelassen – genau richtig für Naturliebhaber. Es gibt Wanderwege, einen Naturerlebnispfad sowie einen alten Aussichtsturm, von dem man einen Blick auf Schwerin und die umliegende Seenlandschaft hat.
Mit diesem Bericht wollen wir euch an dieser Naturexkursion teilhaben lassen. Die von Torsten Richter gefundenen und bestimmten Ascomyceten auf Kaninchenwerder stellen wir euch in einem gesonderten Beitrag vor.
Trotz Mangels an Frischpilzen aufgrund der vorherigen Trockenheit konnten wir immerhin beachtliche 46 Pilz-Arten in unsere Kartierungsliste aufnehmen – auch dank Torsten.
Wir waren uns Alle einig – es war eine sehr schöne Exkursion auf dieser einzigartigen Insel und wir werden ihr sicherlich zu einer anderen Jahreszeit nochmals einen Besuch abstatten.
Catrin

Treffpunkt unserer heutigen Exkursion war der Schiffsanleger der „Weißen Flotte“ in Schwerin-Zippendorf.
Foto: Jürgen Samland

Einen schönen Anblick boten die vielen kleinen Segelboote auf dem Schweriner See.
Foto: Christian Boss

Die kleinen „Nuss-Schalen mit dem Segel“ sind Optimisten-Jollen für Kinder und Jugendliche, die heute am 29. Schweriner Marstall-Cup 2025 teilnahmen.
Foto: Christian Boss

Los ging es vom Schiffsanleger in östliche Richtung un die Insel. Der mit Kastanien gesäumte Wanderweg war ehemals als Allee am Ufer des Sees angelegt.
Foto: Jürgen Samland

Torsten brachte uns dann auch einige Pilzchen aus dem Ried mit. Weißer Adernabeling (Delicatula integrella)
Foto: Christian Boss

Rundsporiger Sumpf-Tintling (Coprinopsis kubickae) an äußeren Blattscheiden der Sumpf-Segge (Carex acutiformis).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Braungefleckter Tintling (Coprinopsis tigrinella) an äußeren Blattscheiden der Sumpf-Segge (Carex acutiformis).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Aber auch wir wurden am Wegrand fündig. Halsband-Schwindling (Marasmius rotula).
Foto: Christian Boss

Marasmius rotula (Halsband-Schwindling) als Makroaufnahme mit seinem deutlich sichtbarem „Halsband“ bzw. Kragen.
Foto: Christopher Engelhardt

Nach Regen finden wir sehr oft an toten Baumresten den Blut-Milchpilz (Lycogala epidendrum).
Foto: Jürgen Samland

Rostbrauner Feuerschwamm (Fuscoporia ferruginosa) – nach neuester Systematik eventuell gar nicht mehr so einfach zu bestimmen.
Foto und Bestimmung: Christopher Engelhardt

Wir erreichten den Aussichtsturm, der am 25. Mai 1895 auf der mit immerhin 18 Metern höchsten Erhebung auf Kaninchenwerder – dem Jesarberg – eröffnet wurde. Der Turm ist bis zur Spitze 22 m hoch – die Aussichtsplattform befindet sich in 15 m Höhe.
Foto: Christian Boss

Blick von der Plattform des Aussichtsturms über die Baumwipfel in den wolkenverhangenen Himmel.
Foto: Christian Boss

Vom Aussichtsturm aus war diese fruchtende Esche (Fraxinus excelsior) quasi auf Augenhöhe zu bestaunen.
Foto: Christopher Engelhardt

Die Gelbe Rosskastanie kommt aus dem Östlichen Nord-Amerika. Die Borke erinnert etwas an die der Platane, denn sie löst sich in großen, rundlichen flachschuppigen Platten ab. Die ansonsten auf unserer Exkursion überall an den Rosskastanien zu findenden Blattminen der Rosskastanienminiermotte befällt diese Art nicht.
Foto: Christian Boss

Viele Insekten gab es aufgrund des diesigen Wetters und Nieselregens nicht zu sehen. Grünader-Weißling (Pieris napi). Zum Lebensraum des Rapsweißlings gehören feuchte, grasige Orte mit etwas Schatten, Waldränder, Baumhecken, Fettwiesen und bewaldete Flusstäler.
Foto: Christian Boss

Die Hausmutter (Noctua pronuba) ist ein Schmetterling aus der Familie der Eulenfalter (Noctuidae). In der Nacht dringt sie oft in Häuser ein, um tagsüber darin zu ruhen. Deshalb bekam sie auch den Namen Hausmutter.
Foto: Christian Boss

Und dieser Goldglänzende Rosenkäfer (Cetonia aurata) macht seinem Namen alle Ehre. In Deutschland gehört er zu den geschützten Käferarten und wurde zum Insekt des Jahres 2000 gewählt.
Foto: Christian Boss

Die Braune Hundezecke (Rhipicephalus sanguineus) stammt ursprünglich aus Nordafrika und ist an warme trockene Bedingungen angepasst. Von dort hat sie sich zwischen dem 50. nördlichen und dem 35. südlichen Breitengrad unter natürlichen Bedingungen nahezu weltweit verbreitet. In der warmen Jahreszeit kann sie auch nördlich der Alpen angetroffen werden
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Junge Buckeltrameten (Trametes gibbosa). Die Poren sind weißlich bzw. cremefarben und unregelmäßig länglich-getreckt.
Foto: Christian Boss

Waben-Stielporling (Polyporus alveolaris) mit großen Poren und dem wellig-umgerollten Rand.
Foto: Christopher Engelhardt

Am Wegrand der häufige Hexenkraut-Rost (Puccinia circaeae) an Gewöhnlichem Hexenkraut.
Foto: Catrin Berseck

Ein kleiner Pilz namens Hymenoscyphus fraxineus (auch bekannt als Falsches Weißes Stengelbecherchen) hat auf Kaninchenwerder viele Eschen – so auch dieses alte Exemplar mit seiner ausladenden Krone – zu Fall gebracht. Der in den 90-er Jahren aus Ostasien eingeschleppte Pilz ist eine ernste Bedrohung für die Esche als Baumart.
Foto: Jürgen Samland

Eine riesige alte Esche. Kaninchenwerder wurde früher beweidet – dadurch entstanden diese „Hudebäume“. Sie weisen große, ausladende Baumkronen mit kräftigen, stark verzweigten Ästen auf, da sie durch den Viehverbiss des nachkommenden Jungwuchses, frei von Konkurrenzdruck durch andere Pflanzen mit weiten Abständen zueinander standen. Bis 1970 wurden auf der Insel Rinder gehalten.
Foto: Christian Boss

Der über über Jahre auf der Insel wehende Westwind hat diese Schrägstellung der Bäume in die dem Wind abgewandte Richtung verursacht.
Foto: Christian Boss

Kein Sumpf ist vor Torsten sicher… Seinen tollen nachbestimmten Ascomyceten-Funden widmen wir einen gesonderten Beitrag.
Foto: Christian Boss

Unser Erinnerungsfoto am Westufer des Schweriner Sees.
V.l.n.r. hinten: Jürgen, Christian, Chris, Catrin, Torsten – vorne: Katarina, Andrea, Katrin
Die Artenliste von der Insel Kaninchenwerder – MTB 2334/441 SO:
Fastgestielter Blattstreu-Kotling (Ascobolus foliicola), Münzenförmige Kohlenbeere (Biscogniauxia nummularia), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Brauner Filzmattenkugelpiz (Chaetosphaerella phaeostroma), Rundsporiger Sumpf-Tintling (Coprinopsis kubickae), Braungefleckter Tintling (Coprinopsis tigrinella), Pokalförmiges Stängelbecherchen (Cyathicula cyathoida), Weißer Adernnabeling (Delicatula integrella), „Goldersbach Haarbecherchen“ (Dennisiodiscus goldersbach nom.prov.), Gras-Kernpilz (Epichloe typhina), Eichen-Mehltau (Erysiphe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Rostbrauner Feuerschwamm (Fuscoporia ferrigunosa), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Gemeiner Wurzelschwamm (Hetereobasidium annosum), Eschen-Kohlenbeere (Hypoxylon petriniae), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hypoxylon cohaerens), Gemeiner Spaltkohlenpilz (Hysterium angustatum), Vielgestaltige Kohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Schwefelporling – alte FK (Laetiporus sulphureus), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Gewittergraues Seggen-Weichbecherchen (Mollisia asteroma), Schimmerndes Weichbecherchen (Mollisia coerulans), Septiertsporiges Seggen-Weichbecherchen (Mollisia luctuosa), Fettes Seggenweichbecherchen (Mollisia pilosa), Orangeroter Helmling (Mycena acicula), Bogenblättriger Helmling (Mycena speirea), Bienenwaben-Stielporling (Neofavolus alveolaris), Scharlachrotes Pustelpilzchen (Neonectria coccinea), Brombeerrost (Phragmadium violaceum), Hexenkruat-Rost (Puccinia circaeae), Veränderlicher Spaltporling (Schizophora paradoxa), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Bewimperter Schildborstling (Scutellinia crinita), Ellipsoidsporiges Kurzzellen-Filzgewebe (Tomentella ellisii), Striegelige Tramete (Trametes hirsuta), Buckel-Tramete (Trametes gibbosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Bergahorn-Mehltau (Uncinula bicornis), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon), Langstielige Ahorn-Holzkeule (Xylaria longpipes)
03.07.2025 – MTB 2134/3 bei Beidendorf
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Wismar
03. Juli 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2134/3 – bei Beidendorf

Dieser Weg durch ein kleines Waldstück nördwestlich von Beidendorf gehörte unter anderem auch zu unserem heutigen Exkursionsgebiet. Es gab dort hauptsächlich Stieleichen, Birken, Buchen und Bergahorn auf lehmigen Boden.
Foto: Angeli Jänichen
Heute – ausnahmsweise an einem Donnerstag – trafen sich 5 Freunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. und 1 Gast zu unserer Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Wismar. Wir mussten diese Exkursion aufgrund der extremen Hitze am Mittwoch um einen Tag verschieben.
Wir trafen uns westlich des Ortes Beidendorf in einem für uns alle unbekannten Gebiet. Unser Versuch, das anvisierte Waldgebiet in nördlicher Richtung zu erreichen, wurde dann auch gleich durch einen eingezäunten Waldbereich gestoppt. Also gingen wir östlich in Richtung Beidendorf durch eine Birkenallee zum Friedhof und von dort weiter in das Waldgebiet Richtung Luttersdorf.
Aufgrund der vorausgegangenen Hitzewelle waren unsere Erwartungen bezüglich Frischpilzen nicht so hoch – wir waren aber erstaunt, doch so einiges zu finden.
Da wir alle sehr naturinteressiert sind, ist es trotzdem nie langweilig. Wir beschäftigen uns mit Allem links und rechts der Pilze bzw. des Weges. Jeder bringt sich und sein Wissen ein – sei es über Bäume, Pflanzen, Insekten usw. – so dass wir immer Alle auf diesen Exkursionen voneinander lernen.
Hier ein paar Eindrücke von der heutigen Exkursion. Falls wir euer Interesse geweckt haben – die nächsten Termine findet ihr unter diesem link.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Baumkunde mit Christian, der uns hier erklärt, wie man die Stieleiche nicht nur an den langgestielten Fruchtkörpern, sondern auch an deren Blattform erkennt.
Foto: Angeli Jänichen

Uns hinderte ein eingezäuntes Waldgebiet am Weitergehen – also wieder zurück an einer Plantage mit Nordmanntannen vorbei. Viele davon hatten mehrere Baumspitzen.
Foto: Angeli Jänichen

Kleiner Odermennig (Agrimonia eupatoria), der mit seinem reichlichen Pollenangebot Schwebfliegen, Fliegen und Honigbienen zur Bestäubung anlockt.
Foto: Angeli Jänichen

In Beidendorf angekommen starteten wir auf dem Friedhof. Die Kirche in Beidendorf ist ein auf Granitsteinen gegründeter gotischer Backsteinbau und wurde bereits 1230 im Ratzeburger Zehntregister erwähnt und gehörte damals noch zum Bistum Ratzeburg.
Foto: Angeli Jänichen

Am Friedhof begrüßte uns an der Eingangspforte an einer Linde gleich dieser Schuppige Porling (Polyporus squamosus).
Foto: Angeli Jänichen

Diesen Hexenring haben Nelkenschwindling (Mariasmus oreades) verursacht – hier schon eingetrocknet.
Foto: Angeli Jänichen

Ein weiterer Vertreter der Schwindlinge ist der Halsband-Schwindling (Marasmius rotula).
Foto: Angeli Jänichen

Er hat zu einem Kollar (Halsband) zusammengeheftete Lamellen, das um die Stielspitze herum verläuft.
Foto: Christian Boss

Pflaumen-Feuerschwamm (Phellinus tuberculosus). Die Fruchtkörper werden oft an der Unterseite von schräg wachsenden Ästen gebildet und laufen über mehrere Zentimeter am Ast herab.
Foto: Christian Boss

Der Pflaumen-Feuerschwamm in seiner typischen Form: Fruchtkörper, die relativ kleine hellbraune Hüte haben und eine große grau- bis gelbbraune Porenschicht ausbilden.
Foto: Angeli Jänichen

Am Wegrand in der Hecke ebenfalls Mahonien (Mahonia) mit ihren reifenden Früchten – eine Pflanzengattung in der Familie der Berberitzengewächse (Berberidaceae). Bei den braunen Flecken auf den Blättern handelt es sich um einen Pilz.
Foto: Christian Boss

An diesen Kastanienblättern handelt es sich nicht um einen Pilz. Verantwortlich sind hier die Larven der Rosskastanienminiermotte (Cameraria ohridella). Allerdings wird nur die Weißblütige Rosskastanie (Aesculus hippocastanum) von den kleinen Insekten befallen. Bei der Roten Rosskastanie sterben die Larven aus bisher unbekannten Gründen. Die Fraßgänge (Minen) der Larven führen zu einer schnellen Braunfärbung und damit zum langsamen Welken der Blätter schon im Sommer.
Foto: Angeli Jänichen

Im Wald begegneten wir mehreren Exemplaren des Breitblättrigen Rüblings (Megacollybia platyphylla).
Foto: Christian Boss

Hier sehen wir die auffallend „breiten Blätter“ = tiefe Lamellen, die dem Pilz seinen deutschen Namen einbrachten. Der Pilz hat durch diese tiefen Lamellen kaum Hutfleisch.
Foto: Angeli Jänichen

Die fast immer allgegenwärtigen Grünblättrigen Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare) besiedeln tote Baumstubben auch so langsam wieder.
Foto: Angeli Jänichen

Nicht mehr bestimmbare ältere und eingetrocknete Exemplare der Faserlinge (Psythyrella sp.).
Foto: Maria Schramm

Neben einer Stinkmorchel (Phallus impudicus) fanden wir nicht etwa die typischen Hexeneier. Ein Griff von Maria nach dem vermutlichen Hexenei ließ sie sofort zurück zucken. Daneben lag tatsächlich ein richtiges Ei…
Foto: Angeli Jänichen

Blick in ein Weizenfeld am Wegrand mit Kornblumen und Kamille. Weizen erkennt man übrigens an den kurzen Grannen.
Foto: Christian Boss

Der bekannteste seiner Art – Siebenpunkt-Marienkäfer (Coccinella septempunctata). Er ernährt sich von Blattläusen – insgesamt frisst ein Käfer während seiner Entwicklung etwa 400 Blattläuse.
Foto: Christian Boss

Wir verließen den Wald dann wieder und gingen ein Stück den Weg in Richtung Lutterstorf.
Foto: Angeli Jänichen

Maria freut sich über ihrem Blumenstrauß und Christian recherchiert gerade am Handy über irgendeinen Falter – seinem neuen Interessengebiet.
Foto: Angeli Jänichen

Der Schmetterling des Jahres 2019 – Tagpfauenauge (Aglais io). Das unverkennbare und auffälligste Merkmal sind die an jeder Vorder- und Hinterflügelspitze gut erkennbaren, schwarz, blau und gelb gefärbten Augenflecken. Der Artname leitet sich von Io, einer Geliebten des Zeus, aus der griechischen Mythologie ab.
Foto: Angeli Jänichen

Brauner Waldvogel, Schornsteinfeger (Aphantopus hyperantus) mit kleinen gelblich umrandeten Augenflecken. Die Anzahl und Größe der Augenflecken kann variieren. Auch dieser Name kommt aus der griechischen Mytholgie – Hyperantus, der Sohn des Ägyptus.
Foto: Angeli Jänichen

Wieder im Wald angekommen – Baumkunde die Zweite. Christian erklärt, wie man den Berg-Ahorn (Acer pseudoplatanus) anhand seiner Blätter vom Spitz- und Feldahorn unterscheiden kann.
Foto: Angeli Jänichen

Nein – es ist nicht so, wie es auf den ersten Blick aussieht – Angeli ist nicht gestürzt! So etwas nennt man „vollen Körpereinsatz“…
Foto: Christian Boss

Und der volle Einsatz hat sich gelohnt – ein wunderschönes Foto von 2 jungen Perlpilzen (Amanita rubescens) auf dem Waldweg.
Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir Vertreter der Rotfußröhrlinge auf dem Weg unter Eichen, die nicht auf Artebene genau bestimmt wurden.
Foto: Angeli Jänichen

Ein Champignon auf einer Wiese ist nicht immer automatisch ein „Wiesenchampignon“ – es gibt immerhin 60 verschiedene Arten, wovon einige auf einer Wiese wachsen können…
Foto: Christian Boss

Aber in diesem Fall handelt es sich tatsächlich um den Wiesen-Champignons (Agaricus campestris), auch unter dem Namen Feld- oder Wiesenegerling bekannt.
Foto: Angeli Jänichen

Unser Erinnerungsfoto aus Beidendorf.
V.l.n.r.: Christian, Catrin, Wibke, Angeli, Sylvina, Maria.
Foto: Angeli Jänichen
Die Artenliste bei Beidendorf – MTB 2134/232 SW:
Wiesen-Champignon (Agaricus campestris), Perlpilz (Amanita rubescens), Mahonienrost (Cumminisiella mirabilissima), Eichenmehltau (Erysiohe alphitoides), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alte FK (Fomitopsis betulina), Gelbe Lohblüte (Fuligo septica), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Nelkenschwindling (Marasmius oreades), Halsband-Schwindling (Marasmius rotula), Breitblättriger Rübling (Megacollybia platyphylla), Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus), Pflaumenfeuerschwamm (Phellinus tuberculosus), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon)
Pilze/Wetter Juli 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im Juli 2025
02.07.2025 – Mittwoch
Heute hätte eigentlich unsere Kartierungsexkursion statt gefunden. Aufgrund der für heute vorhersagten Hitze haben wir unserer Mittwochsexkursion auf Donnerstag – also morgen – verschoben.
Angeli hatte mir noch einige Fotos von Ihren Pilzfunden aus ihrem Lieblingshabitat vom Juni geschickt, die ich euch nicht vorenthalten möchte.
Darunter auch obige Gruppe Riesenchampignons (Agaricus augustus) – auch Braunschuppiger Riesenegerling genannt.
Highlight unter ihren Funden war allerdings die nicht sehr häufig anzutreffende Verzweigte Becherkoralle (Artomyces pyxidatus) – Pilz des Jahres 2015. Diese besonders schöne und ungewöhnliche Pilzart aus der Gruppe der Korallenpilze braucht das Totholz von abgestorbenen Baumstämmen zum Überleben.
Angeli und Catrin

Die Verzweigte Becherkoralle (Artomyces pyxidatus) ähnelt auf den ersten Blick den großen Korallenpilzen der Gattung Ramaria, ist aber mit diesen überhaupt nicht verwandt.
Foto: Angeli Jänichen

Die fast senkrecht aufsteigenden Äste der Verzweigten Becherkoralle erweitern sich oben zu einem becherförmig eingeftieften Gipfel. Die jungen Verzweigungen an den Astenden erinnern an kleine Kronen.
Foto: Angeli Jänichen
03.07.2025 – Donnerstag
Heute trafen wir uns – 5 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. und 1 Gast zu unserer Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Wismar.
Wir hatten uns im Vorfeld ein kleines uns unbekanntes Waldgebiet nördlich von Beidendorf in Richtung Lutterstorf ausgesucht.
Aufgrund des unbekannten Habitats und der vorausgegangenen Hitzewelle an den beiden Vortagen von über 35 Grad waren unsere Erwartungen bezüglich Frischpilzen gedämpft. Aber es geht bei diesen Exkursionen ja um die Kartierung – also Bestandsaufnahme von zu dem Zeitpunkt vorhandenen und sicher bestimmbaren Pilzen.
Und es gibt neben den Pilzen auch immer andere interessante Dinge in der Natur zu entdecken. So auch heute.
Den vollständigen Bericht findet ihr hier.
Catrin
05.07.2025 – Sonnabend
Wie wir hier bereits zeigen konnten, gibt es schon stellenweise Pfifferlinge.
Pfifferlinge gehören zu den Leistlingen – sie haben Leisten anstatt Lamellen. Leisten sind im Gegensatz zu Lamellen direkt mit dem Hutfleisch verwachsen und wirken wie kleine, teilweise verästelte Verdickungen direkt am Hutfleisch.
Dabei gibt es nicht „den“ Pfifferling allgemein – es kommen in Europa 8 verschiedene Arten vor. Zwei dieser Arten habe ich diese Woche gefunden – den Echten Pfifferling und den Blassen Pfifferling.
Sie unterscheiden sich nicht nur durch ihr Aussehen – sie sind auch in verschiedenen Habitaten zu finden.

Die bei uns in M/V am häufigsten vertretenen Echten Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) am Standort unter Eichen. Er ist in sandigen nährstoffarmen Laub- und Nadelwäldern zu finden.
Foto: Catrin Berseck

Dickfleischige Blasse Pfifferlinge (Cantharellus pallens) am Standort unter Rotbuchen. Sein anderer Name Blasser Laubwaldpfifferling verweist auf seinen Standort – dem Laubwald auf besseren Böden mit einem gewissen Kalkanteil – wo er gerne unter Eichen und Rotbuchen wächst.
Foto: Catrin Berseck

Auch dieser Echte Pfifferling hat mal wieder eine Bildungsabweichung – eine sogenannte morchelloide Prolifikation – exzessive Bildung von Hymenophoren (Lamellen, Röhren, Stacheln, Leisten, etc.). Es bilden sich auf dem Hutscheitel Leisten, die eine gekräuselte Struktur ähnlich einer Morchel haben.
Foto: Catrin Berseck
06.07.2025 – Sonntag

Eine bunte und farbenfrohe sommerliche Mischung von Speisepilzen durfte heute mit.
Foto: Hanjo Herbort
Heute drehte ich wieder meine Sonntagsrunde durch meinen Hauswald.
Viel Hoffnung hatte ich nicht und anfänglich war auch kaum etwas Nennenswertes zu finden. Dann entschied ich mich, entgegen meiner sonst üblichen Runde an eher lichten und hellen wärmebegünstigten Stellen, mal in die dunkleren Bereiche mit Mischbestand zu gehen.
Und siehe da – plötzlich fand ich sie – die Pilzoasen. Hier und da eingestreut – verschiedene Täublinge, wie Frauentäublinge, Papageientäublinge, Violettstielige Pfirsichtäublinge und Netzstielige bzw. Morgenrottäublinge. Dazu noch Rotfußröhrlinge und Gold- bzw. Lärchenröhrlinge. Aber auch giftige Dickschalige Kartoffelboviste waren schon da.
Es wurde so noch ein erfolgreicher Nachmittag mit einigen schönen Funden.
Hanjo

2 Gold- bzw. Lärchenröhrlinge (Suillus grevillei) – eingerahmt von 2 jungen Violettstieligen Pfirsichtäublingen (Russula violeipes).
Foto: Hanjo Herbort

Die Huthaut des Violettstieligen Pfirsichtäublings ist samtig wie die eines Pfirsichs und gelb bis violett gefärbt. Auch sein Stiel ist – zumindest oft im Alter – violett überlaufen.
Foto: Hanjo Herbort

Giftige Dickschalige Kartoffelboviste (Scleroderma citrinum) auf morschem Holz. Die Hülle (Peridie) ist 2–3 mm dick und hart, die Oberfläche ist felderig oder rissig-schuppig. Das innere Fleisch (Gleba) ist nur jung leicht gelblich, wird aber schnell bräunlich bis schwärzlich und ist mit feinen weißlichen Adern durchzogen.
Foto: Hanjo Herbort
07.07.2025 – Montag

Da ist er – der erste Grüne Knollenblätterpilz (Amanita phalloides) der Saison. Hier sehen wir trotz der Erde die knollig verdickte Basis und Teile der aufrecht abstehenden häutigen Volva.
Foto: Catrin Berseck
Nicht nur Hanjo war am Sonntag unterwegs – ich auch. Allerdings nicht im kalkhaltigen Buchenwald, sondern in meinem Lieblingspark auf sandigem Boden.
Vor einer Woche war dort bis auf eine handvoll Pfifferlinge noch überhaupt nichts von Pilzen zu sehen. Dementsprechend waren meine Erwartungen auch nicht so hoch.
Jedoch gleich am Parkplatz freute ich mich, den ersten Grünen Knollenblätterpilz der Saison zu sehen! Es ist zwar ein tödlich giftiger – aber trotzdem sehr schöner Pilz, den jeder Speisepilzsammler in allen Formen, Farben und Altersstadien unbedingt erkennen sollte.
Auf dem weiteren Weg durch den Park überraschten mich dann auch noch schöne frische Perlpilze und Fleischrote Speise-Täublinge.
Die größeren Niederschlagsmengen vom 23.06.2025 scheinen jetzt so langsam Wirkung beim Pilzwachstum zu zeigen. Es sind ja auch immerhin 14 Tage seit dem vergangen…
Catrin

Diesen tödlich giftigen Vertreter der Wulstlinge sollte jeder Speisepilzsammler kennen. Sein Hut ist nicht immer grün gefärbt – im Alter oder bei starker Sonneneinstrahlung oder Trockenheit bleicht er auch aus.
Foto: Catrin Berseck

Hier essbare Vertreter der Wulstlinge – junge Perlpilze (Amanita rubescens) mit ihrer rübenartigen Knolle und Rottönen.
Foto: Catrin Berseck

Für die Pfanne gab es dann auch noch Fleischrote Speise-Täublinge (Russula vesca).
Foto: Catrin Berseck
08.07.2025 – Dienstag

Netzstieliger Hexen-Röhrling (Suillellus luridus) mit einem lederfarbenen braunen Hut und einem ausgeprägten Stielnetz mitten auf einem Waldweg.
Foto: Catrin Berseck
Bei mir zu Hause wachsen wie jedes Jahr unter ganz alten Eichen gerade die Netzstieligen Hexenröhrlinge (Suillellus luridus). Bestimmt 20 Stück unter einem Baum. Da die sowieso fast immer vermadet sind, kommen sie für mich als Speisepilze nicht in Frage. Ich lasse sie wachsen bzw. den Schnecken als Futter und beobachte sie täglich.
Auch an anderen Stellen, z.B. in meinem Hauswald auf den Waldwegen sowie unter Linden in Parkanlagen finde ich jetzt fast täglich welche. Es ist schon erstaunlich, welche Färbung die Hüte je nach Standort entwickeln können und wie unterschiedlich das Stielnetz teilweise entwickelt ist.
Die Hüte können hellbraun, dunkelbraun, lederfarben, graubraun oder oliv sein. Die Stiele haben eine rötliche, rotbraune oder dunkelbraune Netzzeichnung auf gelblichem Grund, oft sind sie auch komplett rötlich überhaucht.
Catrin

Aber außer dem hier noch nicht zu sehendem Stielnetz es gibt noch andere bestimmungsrelevante Merkmale. Der samtige Hut mit seinen Olivtönen, die orangefarbenen bis rötlichen Röhren und das starke Blauen auf Hut und Stiel an Druckstellen.
Foto: Catrin Berseck

Hier mal ein Exemplar mit einer ganz anderen Hutfarbe und stärkerem Blauen an Druckstellen in einem Park.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir eine Gruppe junger Netzstieliger Hexenröhrlinge, bei denen das Stielnetz noch nicht zu sehen ist.
Foto: Catrin Berseck

Die Netzstieliegen Hexenröhrlinge 2 Tage später – jetzt ist das Stielnetz bereits leicht zu sehen.
Foto: Catrin Berseck
09.07.2025 – Mittwoch
In unseren besseren Buchenwäldern finden wir derzeit die eigentlich nicht so häufig vorkommenden Pfeffer-Milchlinge.
Es gibt davon 2 verschiedenene – den Langstieligen Pfeffer-Milchling (Lactifluus piperatus) und den sehr ähnlichen Grünenden Pfeffer-Milchling (Lactifluus glaucescens). Sie unterscheiden sich nur mikroskopisch durch die Dicke der Huthaut.
Da ich meine gefundenen Exemplare bisher noch nicht mikroskopiert habe, belassen wir es einfach mal beim Pfeffer-Milchling.
Was aber beide Pfeffer-Milchlinge gemeinsam haben – die extrem scharfe pfeffrige Milch.
Der Milchling gilt als Speisepilz – kann aber wegen seiner außerordentlichen Schärfe kaum verzehrt werden. Von manchen Pilzsammlern wird er jedoch getrocknet als Würzpilz oder gut gegrillt oder scharf gebraten gegessen.
Catrin

Die sehr dicht stehenden Lamellen sind am Stiel angewachsen und laufen dann leicht daran herab. Sie sind sehr schmal (oft nur 1,5 mm breit) und weisen einige gleichmäßig verteilte Gabelungen auf. Sie sind weißlich bis cremefarben und später blass fleischfarben oder haben einen cremeorangen Schimmer. Hier sehen wir auch die pfeffrig extrem scharfe austretende Milch.
Foto: Catrin Berseck
10.07.2025 – Donnerstag

Die ersten Riesenporlinge (Meripilus giganteus) der Saison an einem Buchenstubben.
Foto: Hanjo Herbort
Ein kurzer Ausflug nach einem anstrengenden Tag im Büro sollte heute ein Bild von „meiner Seite“ des mit Catrin geteilten Rühner Forstes geben.
So klapperte ich einige Stellen für Flockenstielige Hexenröhrlinge ab, aber es war wie leer gefegt am Waldboden. Nicht ein Fruchtkörper zu sehen.
Da ich nicht so viel Zeit hatte, ging ich den Rückweg auf der Forststraße zurück und fand so am Rand in einer Senke den ersten Riesenporling (Meripilus giganteus) der Saison.
Da er noch jung und an den Rändern sehr weich war, wurde er heute einer Verkostung unterzogen (das hatte ich schon lange mal vor) und gebraten auf Toast verspeist. Ausgesprochen delikat wie ich fand. Die dunkle Verfärbung in der Pfanne tat dem keinen Abbruch.
Nun hoffen wir mal, dass die ausgiebigen Niederschläge der letzten zwei Tage Wirkung zeigen mögen – mein Messbecher zeigte insgesamt 28 Liter auf den Quadratmeter.
Hanjo

Die Riesenporlinge verfärben sich an Druckstellen und beim Braten schwarz. Dennoch ist er ganz jung ein sehr guter Speisepilz, der oftmals unterschätzt wird.
Foto: Hanjo Herbort
11.07.2025 – Freitag
Da morgen unsere Naturexkursion auf Kaninchenwerder statt findet, musste ich mich heute mal etwas ausführlicher mit dem Wetter beschäftigen. Die Fähre fährt bekanntlich bei schlechten Wetterbedingungen nicht… Aber es sieht gut aus – die angekündigten Regengebiete sollten bis 11 Uhr in Schwerin durchgezogen sein.
Verschiedene Kanäle sagen für die nächsten Tage Temperaturen zwischen 20 und 25 Grad voraus sowie weiterhin stellenweise Gewitter und Regen.
Am Rande eines umfangreichen Tiefdruckkomplexes über Polen wird feuchte und mäßig warme Luft nach Mecklenburg-Vorpommern geführt. Auf dem Weg nach Westen erreicht das Tief am Wochenende Nordostdeutschland und sorgt für wechselhaftes und regenreiches Wetter.
Das wären ideale Bedingungen wir das Pilzwachstum. Lassen wir uns einfach überraschen.
Catrin
Wettervorhersage für Schwerin für die nächsten 10 Tage.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
12.07.2025 – Sonnabend
Heute trafen wir uns zur unserer Naturexkursion in Schwerin-Zippendorf. Es ging mit der Fähre auf die Insel Kaninchenwerder. Für die meisten Teilnehmer der erste Besuch dieser wunderschönen Insel im Schweriner See.
Unser Rundgang begann am Anleger auf der Insel in östliche Richtung. Vorbei an der Streuobstwiese betraten wir den Wald und gingen einen Wanderweg in Richtung Aussichtsturm.
Die Insel war nicht immer bewaldet, da hier bis 1831 eine Ziegelei betrieben wurde und das Holz dafür genutzt wurde. Erst nach Ende der Ziegel-Produktion konnte sich die Insel langsam wiederbewalden.
Zurück ging es dann am westlichen Ufer durch die wunderschöne Landschaft.
Es war dieses mal keine reine Pilzexkursion geplant – es war eine Naturexkursion. Die Falter zeigten sich zwar wegen des leicht diesigen und regnerischen Wetters nicht. Aber es gab genug Bäume, Pflanzen und natürlich auch Pilze in dieser schönen Landschaft zu entdecken.
Da Torsten Richter mal wieder mit von der Partie war, konnten wir auch einige seltene Ascomyceten und kleine Tintlinge für unsere Kartierung aufnehmen. Wir haben Torstens Ascomyceten auf Kaninchenwerder dieses mal einen eigenen Beitrag gewidnet.
Den ausführlichen Bericht inklusive der gefundenen Pilzarten findet ihr hier.

Blick bei der Überfahrt mit der Fähre nach Kaninchenwerder auf das Schweriner Schloss.
Foto: Christopher Engelhardt
13.07.2025 – Sonntag
Am Freitag nach der Arbeit habe ich noch mal kurz bei Hanjo im Rühner Forst vorbei geschaut. Außer ein paar überständige Flockenstielige Hexenröhrlinge am Wegrand – die scheinbar Hanjos Augen vorher entgangen waren – habe ich auf der kurzen Runde tatsächlich keine weiteren Pilze entdecken können.
Auf dem Rückweg nach Hause fuhr ich in Rühn durch den Rühner Laden, wo der Tornado in Bützow vor 10 Jahren gewütet hatte und viele der alten Buchen zu Fall gebracht hat. Da es sich dort um ein Landschaftsschutzgebiet handelt, bleiben sie dort als Totholz liegen und sind auch Nährboden für viele Pilze.
Ich habe mich gefreut, den seltenen Wolligen Scheidling (Volvariella bombycina) dort zu finden.
Er gehört zur Familie der Dachpilzverwandten und hat wie diese auch rosa Lamellen – an der Fraßstellen am Hut zu sehen. Namesgebend sind sowohl die große sackartige und häutige Volva (Scheide) und die weiß bis cremefarben feinen, seidigen (wolligen) Faserschüppchen. Er gilt als Speisepilz – sollte aber wegen seiner Seltenheit geschont werden.
Catrin

Der Hut des Wolligen Scheidlings mit seinen fein seidigen radial angeordneten Faserschüppchen.
Foto: Catrin Berseck
14.07.2025 – Montag
Am Sonnabend bin ich auf dem Rückweg von Schwerin über Crivitz gefahren und habe noch mal im Warnowtal bei Gädebehn bei der Rönkendorfer Mühle einen kleinen Zwischenstopp eingelegt.
An den dortigen Steilhängen liegen viele tote Rotbuchenstämme und -äste. Ich dachte mir, dass es bei diesen Witterungsbedingungen dort bestimmt Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) wachsen. Und ich wurde nicht enttäuscht. Es gab sie massenweise in allen Altersstadien – ganz alte Vertrocknete, frische Erntereife und ganz Kleine, die in den nächsten Tagen erntereif werden.
Der Lungenseitling (Pleurotus pulmonarius) ist ein naher Verwandter des Austernseitlings (Pleurotus ostreatus). Er benötigt aber im Gegensatz zum Austernseitling keine niedrigen Temperaturen und kann seine Fruchtkörper bereits im Sommer ausbilden. Der Austernseitling ist für gewöhnlich kräftiger und dickfleischiger und zeigt meist Blautöne in der Huthaut. Lungenseitlinge neigen im Alter auch zum Gilben.
Catrin

Lungenseitlinge sind deutlich gestielt und haben dünne, dichtstehende Lamellen, die nicht ganz bis zum Stielgrund herablaufen.
Foto: Catrin Berseck

Die Hüte der Lungenseitlinge müssen nicht immer weiß sein. Auch beige, blass gelbe oder graue Farbtöne sind möglich.
Foto: Catrin Berseck
15.07.2025 – Dienstag

Schöne große Echte Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) gab es heute im Buchenlaub.
Foto: Catrin Berseck
Heute führte mich mein Feierabendspaziergang mal nach Bützow in einen sandigen Mischwald. Nachdem ich dort die letzten Wochen nicht einen einzigen Pilz zu Gesicht bekommen hatte, habe ich mal meine Pfifferlingsstelle unter Birken aufgesucht. Außer ein paar Rotbraunen Scheidenstreiflingen zeigte sich dort immer noch nichts.
Ich wollte nach 10 Minuten wieder kehrt machen – habe aber dann beschlossen, wenigstens noch dem nahegelegenen Altbuchenbereich, der mit ein paar Nadelbäumen durchmischt ist, einen Besuch abzustatten.
Und da waren sie dann in größerer Anzahl und stattlicher Größe – die Pfifferlinge – gut getarnt im Buchenlaub. Dazu zeigten sich noch ein paar andere Pilze, so dass wir davon ausgehen können, dass die Niederschläge in der letzten Zeit endlich mal zu einem Wachstumsschub führen.
Catrin

Rotbraune Scheidenstreiflinge (Amanita fulva) in verschiedenen Altersstadien. Der Name leitet sich aus den sackartigen Resten der häutigen Gesamthülle „Scheide“, die den ganz jungen Pilz komplett umhüllt (linkes Exemplar) sowie der kammartigen Riefung des Hutrandes „Streifen“ her.
Foto: Catrin Berseck

Gemeiner Gallenröhrling (Tylopilus felleus) – auch Bitterling genannt. Der wissenschaftliche Artname „felleus“ bedeutet „gallenbitter“. Tatsächlich kann ein einziger, irrtümlich für einen Steinpilz gehaltener Fruchtkörper ein ganzes Pilzgericht ungenießbar machen.
Foto: Catrin Berseck

Grünblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare) an einem Baumstubben. Der lateinische Name fascicularis beschreibt die Wuchsform und bedeutet „büschelig“.
Foto: Catrin Berseck

Reihig wachsende, muschelförmige und striegelig behaarte Pseudohütchen charakterisieren den Striegeligen Schichtpilz (Stereum hirsutum).
Foto: Catrin Berseck
16.07.2025 – Mittwoch
Heute stand mal wieder eine Kartierungsexkursion auf dem Plan – der letzte Quadrant des MTB 2134 Wismar. In dem Kartierungsgebiet befindet sich unter anderem der Moidentiner Forst – der schon sehr oft von uns aufgesucht wurde. Wir suchten deswegen ein uns unbekanntes Gebiet aus und trafen uns an der Brusenbecker Mühle nordöstlich von Moidentin.
Dazu an dieser Stelle erst mal nur ein Kommentar von Chris: „Das war eine wunderbare Wanderung heute. Was für traumhafte Plätze, superschöne Aussichten auf den Wallensteingraben, ein naturnaher Wald und ein Rundweg von genau richtiger Länge.“
Und wir konnten auch tatsächlich fast 40 Pilzarten für unsere Kartierung aufnehmen. Dazu gab es gratis mal wieder von unseren vielseitig interessierten Naturfreunden Wissen über Insekten, Pflanzen und Bäume. Auch den Eisvogel konnten wir sehen – aber leider nicht im Foto festhalten.
Den ausführlichen Beitrag findet ihr hier.
Catrin
17.07.2025 – Donnerstag
Am Dienstag hatte ich nachmittags noch etwas in der Nähe von Güstrow zu tun. Das habe ich auf dem Heimweg ausgenutzt, um der Schwinzer Heide südlich des Krakower Sees noch einen kurzen Besuch abzustatten.
Es befinden sich hier überwiegend Kiefernwälder auf sandigen Böden. Besonders im Herbst ein Paradies für Pilzsammler. Aber bei günstigen Witterungsverhältnissen kann es sich auch im Sommer schon mal lohnen, sich auf die Suche nach Pfifferlingen und Täublingen zu begeben.
Da ich nicht viel Zeit hatte, habe ich nur Halt an einen Jungeichen-Waldstück mit anschließenden Kiefern- und Birkenabschnitten gemacht. Mir kam ein Pilzsammler entgegen, den ich freundlich nach seinen Sammelerfolgen fragte. Es kam nur barsch ein „es lohnt sich nicht“ zurück. Da mich solche Aussagen nicht abschrecken, ging ich dann selber mal kurz nachsehen.
Pfifferlinge auf den freien Moosflächen waren komplett abgeertnet – unter dem Eichenlaub war es anscheinend zu aufwendig, mal nachzusehen, so dass ich dort auch noch fündig wurde. Und Täublinge sind dem normalen Pilzsammler wahrscheinlich kaum bekannt, so dass ich sicherlich mit einem vollerem Korb als der nette Herr nach Hause fuhr.
Aber es zeigten sich auch bereits andere Arten, die nun deutlich den Wachstumsschub nach den Niederschlägen der letzten Tage anzeigen.
Catrin

Verschiedene essbare Täublinge. Gelber Graustiel-Täubling (Russula claroflava), 2 Fleischrote Speise-Täublinge (Russula vesca) in verschieden Farbtönen und unten der Orangerote Graustieltäubling (Russula decolorans).
Foto: Catrin Berseck
18.07.2024 – Freitag

Treffender geht es nicht – das Motto zu Beginn unserer heutigen privaten Wanderung in Glave.
Foto: Corina Peronne
Heute habe ich mich nachmittags zu einer privaten Wanderung mit Corina aus der Nähe von Waren-Müritz und Jens aus Berlin getroffen. Jens macht hier gerade einen Wochenendurlaub und hat sich auch für morgen zu unserer öffentlichen Wanderung angemeldet.
Corina, Hanjo und ich treffen uns ab und zu mal aufgrund der weiten Entfernung in der Mitte – der Schwinzer Heide. So auch heute – nur konnte Hanjo heute leider nicht mitkommen.
Es war heute vorwiegend geplant, Speisepilze zu sammeln. Natürlich haben wir auch nach anderen Pilzen Ausschau gehalten und uns über die wachsende Artenvielfalt wahnsinnig gefreut.
Nach dem Motto: „Wad geht ab“ findet ihr den Beitrag hier.
Falls ihr auch etwas mehr über Pilze lernen wollt, könnt ihr auch gerne bei uns eine private Wanderung buchen oder eine Solche als Gutschein verschenken. Sprecht uns einfach an.
Catrin
19.07.2025 – Sonnabend

Das Foto der Terminankündigung: Große und kräftige Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) von einer Wanderung mit Reinhold 2019 im ehemaligen Staatsforst Turloff.
Heute stand eine Öffentliche Wanderung auf dem Plan. Ausgesucht hatte ich im Vorfeld in der Nähe von Dabel den ehemaligen Staatsforst Turloff – ein ähnliches Gebiet auf sandigem Boden, wie gestern in der Schwinzer Heide.
Die Terminankündigung erfolgte mit einem Foto von wunderschönen Pfifferlingen einer früheren Wanderung von Reinhold in diesem Gebiet.
Jens aus Berlin, der sein Wochenende bei uns im schönen Mecklenburg verbringt und Katarina von unseren Pilzfreunden trafen sich mit mir am vereinbarten Ort. Beide hofften, dass sie außer neuem Wissen über Pilze auch Pfifferlinge mit nach Hause nehmen können… Und ich denke mal, bei Beiden wurden die Erwartungen diesbezüglich mehr als übertroffen.
Wir haben tatsächlich so viele Pfifferlinge gefunden, dass wir 3 reichlich einsammeln konnten und uns auf dem Rückweg noch nicht mal mehr nach ihnen umgesehen haben.
Den vollständigen Bericht findet ihr hier.
20.07.2025 – Sonntag
Auch wir waren am Sonnabend unterwegs – hauptsächlich zur Beerenernte.
In den Wäldern bei Banzkow finden sich ausgesprochen viele Heidelbeerbüsche. Und obwohl es noch recht früh im Jahr ist, sind die Heidelbeeren schon reif – etliche zerplatzten schon beim Pflücken zwischen den Fingern. Die Ernte der kleinen Beeren ist etwas mühselig, aber die Arbeit lohnt sich allemal!
Und wenn man schon mal da ist, kann man auch noch gleich von den Waldhimbeeren naschen, auch die sind jetzt reif und lecker. Leider auch ziemlich klein…
Neben Beeren haben die Wälder dort aber natürlich auch Pilze zu bieten. Es ist Pfifferlingszeit! Außer den Pfifferlingen zeigten sich auch viele andere Pilze, z.B. Waldfreund-Rüblinge und Rotbraune Scheidenstreiflinge, am Wegesrand standen ein paar Behangene Faserlinge.
Martina und Dirk

Heidelbeeren wachsen als Halbschattenpflanze in arten- und nährstoffarmen bodensauren frischen Laub- und Nadelwäldern.
Foto: Dirk Fuhrmann

Waldhimbeere, die Wildform der Kulturhimbeere, ist kleinfruchtig, steht aber im Geschmack keinesfalls nach. Sie gilt als Waldpionier, der gern Kahlflächen in Beschlag nimmt.
Foto: Dirk Fuhrmann

Junge Behangene Faserlinge (Psathyrella candolleana). Charakteristisch ist bei diesem Pilz aus der Familie der Mürblingsverwandten der Saum aus weißen Velumresten auf den Hüten junger Exemplare.
Foto: Dirk Fuhrmann
21.07.2025 – Montag

Der wichtigste Anzeigerpilz für Steinpilze und Hexenröhrlinge: Mehl-Räsling oder Mehlpilz (Clitopilus prunulus).
Foto: Catrin Berseck
Letzte Woche habe ich die ersten Mehl-Räslinge an verschiedenen Stellen gefunden und mich gefreut.
Ich habe bei Reinhold das meiste Wissen über Pilze erworben. Als ich auf einer Wanderung das erste mal Mehl-Räslinge gefunden habe, sagte Reinhold zu mir: „Das ist der wichtigste Pilz, den du dir unbedingt einprägen solltest“.
Also habe ich mir Folgendes gemerkt:
* Die Mehl-Räslinge wachsen einzeln oder in kleinen Gruppen
* Sie haben einen breiten, dickfleischigen gewölbten und welligen Hut mit einem eingerollten Rand und einem breiten Buckel
* Die Oberfläche ist weißlich bis blassgrau-beige oder gelblich-cremefarbene fein bereift, bei Nässe klebrig oder schmierig
* Die Lamellen sind gedrängt stehend und am Stiel herablaufend – jung weiß und später rosa gefärbt
* Er riecht und schmeckt mehl- oder gurkenartig
Nachdem ich mir damals den Pilz angesehen hatte und Reinhold ihn mehr genau erklärte, rief er „Steinpilzalarm“ aus. Und genauso kam es… Nachlesen könnt ihr das im Tagebuch August 2022 am 28.08.2022 ff.
Warum? Der Mehl-Räsling ist neben dem Pfefferröhrling und dem Fliegenpilz der beste Steinpilz-Anzeiger. Diese Arten haben ähnliche Ansprüche an ihren Lebensraum, so kann das Vorkommen eines Pilzes auch auf das Vorhandensein des anderen hinweisen. Man kann also den Mehl-Räsling als „Steinpilz-Anzeiger“ betrachten und umgekehrt.
So war es auch nicht verwunderlich, dass ich heute in der Nähe einer Stelle der Mehl-Räslinge von letzter Woche Steinpilze gefunden habe…
Catrin

Sommersteinpilze (Boletus reticulatus) heute am Standort der letzte Woche gefundenen Mehlräslinge unter Eichen.
Foto: Catrin Berseck

Sommersteinpilze (Boletus reticulatus) von Phillip toll in Szene gesetzt.
Die Huthaut ist feinfilzig bis körnig und variiert farblich in verschiedenen helleren Brauntönen bis nussbraun. Der Stiel ist mit einem Netz von gestreckten Maschen aus erhabenen, hellen, weißlichen Adern gekennzeichnet, das sich nicht selten über den ganzen Stiel erstreckt.
Foto: Phillip Buchfink
22.07.2023 – Dienstag
Bleiben wir noch bei den Mehl-Räslingen – die nicht nur Anzeiger-Pilz für Steinpilze, sondern auch für Hexenröhrlinge und Wurzelnde Bitterröhrlinge sein können.
Am 17.07.2025 habe ich auf einem ganz kleinen Dorfplatz ebenfalls Mehl-Räslinge gesehen. Nach dem gestrigen Fund der Sommersteinpilze in meiner Mittagspause am Standort der Mehl-Räslinge war dies gestern nach Feierabend Grund genug für mich, diesen weiteren Standort ebenfalls noch mal aufzusuchen.
Schon aus dem Auto sah ich die Bescherung – auf einem kleinen Areal von max. 10 x 10 m drängten sich Massen an Netzstieligen Hexen-Röhrlingen (Suillellus luridus) in allen Größen, Formen und Farben unter einer jungen Eiche.
Also liebe Speisepilzsammler – haltet ebenfalls nach Mehl-Räslingen Ausschau und merkt euch die Stellen!
Catrin

Man konnte kaum treten, so viele Netzstielige Hexen-Röhrlinge waren auf dem kleinen Dorfplatz innerhalb von 4 Tagen gewachsen.
Foto: Catrin Berseck

Gedrängt stehende Netzstielige Hexen-Röhrlinge (Suillellus luridus) gestern am Standort im Regen.
Foto: Catrin Berseck
23.07.2025 – Mittwoch

Junger Wolliger Scheidling (Volvariella bombycina) heute an einem seltenen Eschen-Ahorn bzw. Eschenblättrigen Ahorn (Acer negundo).
Foto: Catrin Berseck
Heute möchte ich mal einen besonders schönen Pilz zeigen und genau vorstellen – den Wolligen Scheidling (Volvariella bombycina). Phillip und ich haben ihn gerade unabhängig voneinander an verschiedenen Standorten gefunden.
Scheidlinge gehören zu den Dachpilzverwandten (Familie Pluteaceae mit den Gattungen Pluteus und Volvariella). Im Gegensatz zu den Dachpilzen (Pluteus) haben die Scheidlinge (Volvariella) eine sackartige häutige Scheide am Stielgrund.
Der weiße mit weißwolligen Fasern dicht bedeckte Hut ist erst eiförmig und dann kegelig – der Hutrand überstehend. Die erst weißen und dann aufgrund des rosafarbenen Sporenpulvers später rosa gefärbten Lamellen sind gedrängt stehend. Der weiße unberingte Stiel entspringt einer oft tief im Substrat steckenden außen braunwolligen, lappigen Basalknolle. Geruch und Geschmack sind rettichartig.
Der Wollige Scheidling (Volvariella bombycina) ist ein essbarer Pilz, wird aber aufgrund seiner Seltenheit als nicht empfehlenswert zum Verzehr eingestuft. Manchmal sollte man sich auch einfach nur an einem schönen Pilz erfreuen und ihn in der Natur belassen.
Catrin

Gleich drei wunderschöne Wollige Scheidlinge (Volvariella bombycina) nebeneinander wieder mal von Phillip perfekt in Szene gesetzt.
Foto: Phillip Buchfink
24.07.2025 – Donnerstag

Netzstielige Hexen-Röhrlinge (Suillellus luridus) findet man unter Laubbäumen – nach meiner Erfahrung vorwiegend unter Linden – aber auch Eichen und Buchen. Sie sind kalkliebend und daher auf trockenen, lehmigen und basischen Böden häufig zu finden.
Foto: Catrin Berseck
Wir wollen euch ja hier auf dieser „Tagebuchseite“ nicht nur Pilze näher vorstellen, sondern auch darüber berichten, was gerade so in Mecklenburg wächst. Das ist regional natürlich unterschiedlich. Es kommt immer darauf an, wie viele Niederschläge es in den einzelnen Regionen gab und welche Bodenverhältnisse vorherrschend sind.
Das es in den sauren Laub- und Kiefernwäldern derzeit Pfifferlinge und Speisetäublinge gibt, sollte der fleißige Tagebuchleser und Speisepilzsammler mittlerweile schon mitbekommen haben. Aber auch die Körnchen-Röhrlinge sind seit dieser Woche zu finden.
Auch Parkanlagen – vor allem mit alten Eichen, Linden und Buchen – sind derzeit ein lohnendes Habitat. Ich habe dort die letzten Tage extrem viele Netzstielige Hexenröhrlinge finden können und vereinzelt sind auch die Sommersteinpilze bereits wieder am Start. Flockenstielige Hexenröhrlinge sollte es dort auch bald wieder geben – kleine Exemplare habe ich bereits gesichtet.
Auch auf Rasenflächen, Wiesen und Weiden tut sich mittlerweile so einiges. Allen voran die Nelkenschwindlinge, die nach dem Regen der letzten Tage jetzt ihren großen Auftritt haben. Vereinzelt gibt es auch bereits schon verschiedene Champignon-Arten und Riesenschirmlinge.
Hanjo und ich haben festgestellt, dass es nur im kalkhaltigen Buchenwald derzeit noch etwas mau aussieht – das wird sich aber hoffentlich in den nächsten Tagen nach den ergiebigen Niederschlägen ändern.
Catrin

Körnchen-Röhrlinge (Suillus granulatus) wachsen auf kalkhaltigem Boden unter Kiefern. Am 17.07.2025 am Standort fotografiert.
Foto: Catrin Berseck

Die gelblich-weiße Oberfläche des Stiels des Körnchen-Röhrlings ist mit den namensgebenden gleichfarbigen Körnchen besetzt. Die Röhren sind jung zitronengelb und milchig tropfend und werden im Alter ockergelb.
Foto: Catrin Berseck

Auch die Wurzelnden Bitter-Röhrlinge (Caloboletus radicans) sind derzeit u.a. in Parkanlagen meist bei Eichen, Linden, Buchen auf kalkreichem Boden zu finden.
Foto: Catrin Berseck

Im Vergleich: Links Fahler Röhrling (Hemileccinum impolitum) – rechts Wurzelnder Bitter-Röhrling (Caloboletus radicans) am 22.07.2025 am Standort. Beide Pilze sind relativ selten.
Foto: Catrin Berseck

Frische Nelken-Schwindlinge (Marasmius oreades) finden wir derzeit nach den Regenfällen wieder auf Wiesen, Weiden, auf Rasenflächen in Gärten und Parks sowie in grasigen Wäldern. 22.07.2025 am Standort.
Foto: Catrin Berseck

Wie alle Schwindlinge verfügt er über die Fähigkeit, gänzlich ausgetrocknet wieder aufzuleben und weiterzuwachsen. Dafür benötigt er lediglich Regen. Hier sehen wir alte Exemplare der Nelkenschwindlinge – zu erkennen am gerieften Hutrand und dem glasigen Aussehen. Solche Exemplare sollten nicht mehr zu Speisezwecken gesammelt werden.
Foto: Catrin Berseck
25.07.2025 – Freitag

Und da ist er wieder – der relativ selten zu findende Kornblumen-Röhrling (Gyroporus cyanescens).
Foto: Corina Peronne
Heute trafen Corina und ich uns am späten Nachmittag erneut in der Schwinzer Heide – Jens kam etwas später dazu.
Wir wollten mal nachsehen, was sich innerhalb einer Woche so getan hat. Dabei konnten wir feststellen, dass die Artenvielfalt der Pilze in den sauren sandigen Nadel- und Laubwäldern so langsam zu nimmt.
Jens ging es – wie letzte Woche auch – hauptsächlich darum, seine Artenkenntnis zu erweitern. Aus diesem Grund kommt er auch morgen zu unserer Kartierungsexkursion nach Kühlungsborn mit.
Corina und ich hatten bereits von zu Hause einige Pilze mitgebracht und zeigten und erklärten ihm diese. Mit den heute gefundenen Pilzen hoffen wir, dass er wieder einiges dazu lernen konnte. Eine kleine Auswahl zeigen wir euch hier.
Catrin und Corina

Der Kornblumen-Röhrling kommt auf sandigen Böden in Laub- und Nadelwäldern, besonders bei Birken, Buchen und Eichen vor. Man findet ihn meist auf oder unmittelbar an den Waldwegen.
Foto: Corina Peronne

Apfel-Täubling (Russula paludosa). Junge Exemplare sehen mit ihrer lebhaft roten und gelbroten Färbung wie Äpfel aus. Der weiße Stiel ist oft rötlich überhaucht und wird im Alter markig-hohl.
Foto: Corina Peronne

Nicht selten kommt am gleichen Standort wie der Apfeltäubling auch der Orangerote Graustiel-Täubling (Russula decolorans) vor. Besonders rotgefärbte Exemplare können mit dieser Art verwechselt werden. Das Fleisch und der Stiel von älteren Fruchtkörpern graut oder schwärzt, sodass die beiden Arten leicht unterschieden werden können. Außerdem fehlt dem Graustiel-Täubling die rote Tönung des Stieles.
Foto: Catrin Berseck

Der Gelbe Graustiel-Täubling (Russula claroflava) gilt in Norddeutschland als Charakterart des Birkenbruchs.
Foto: Catrin Berseck

Der Schwarzschneidige Dachpilz (Pluteus nigrofloccosus) mit der charakteristisch dunklen Lamellenschneide wächst ausschließlich auf Kiefern oder Fichten.
Foto: Catrin Berseck
26.07.2025 – Sonnabend

Mit dem Wetter hatten wir heute in Kühlungsborn Glück. Der Stein blieb trocken und warf zwischen der leichten Bewölkung auch mal Schatten.
Foto: Catrin Berseck
Heute waren trafen sich 5 Pilzfreunde unseres Vereins zur Kartierung im MTB 1836 Kühlungsborn im gleichnamigen Ort. Da der größte Teil dieses Messtischblattes in der Ostsee liegt, stand uns nur der nördliche Teil des Kühlungsborner Stadtwaldes zu Verfügung. Wir hatten daher beschlossen, eine Ganztagsexkursion zu machen und gleich die ersten beiden Quadranten an einem Tag abzuarbeiten.
Auf dem Weg vom Parkplatz in den Stadtwald außerhalb unseres Karteierungsgebietes fanden wir einige Kleinpilze, wie Nelkenschwindlinge, Tintlinge, Faserlinge, Ackerlinge und Samthäubchen. Pilzarten, die wir nach den vergangenen Regenfällen jetzt überall auf Wiesen und an Wegrändern antreffen.
Im Stadtwald selber hielt sich das Vorkommen an Frischpilzen noch auffällig zurück. Nur hier und dort war vereinzelt mal ein Exemplar zu finden. Als Massenpilz waren dort allerdings die Samtfußkremplinge vertreten. Aber auch ein paar Täublinge, Perlpilze und ein älteres Exemplar eines Gemeinen Steinpilzes konnten wir im Buchenwaldabschnitt finden.
Den kompletten Bericht inkl. der schönsten Fotos findet ihr hier.
Catrin

Junge stärker gilbende Champignons aus der Sektion Arvensis. Das sind die nach Anis, Bittermandel oder Weihnachtsplätzchen riechenden Champignons. So jung nicht eindeutig bestimmbar – es könnte sich um den Schiefknolligen Anisegerling (Agaricus essettei) handeln.
Foto: Catrin Berseck
Sonntag, 27.07.2025
Nachdem ich die letzten Tage fast nur in Parkanlagen oder sauren Nadelwäldern unterwegs war, habe ich heute mal eine kurze Stippvisite in meinem kalkhaltigen Buchenwald gemacht.
Wie bereits vermutet – dort herrscht noch immer Ruhe vor dem Sturm. Ganz wenige Täublinge waren zu sehen – nur eine Stelle war reichlich mit Hainbuchen-Raufußröhrlingen besetzt. Ansonsten gähnende Leere – nur massenweise Nacktschnecken und Frösche.
Da wir schon mal bei den Raufüßen bzw. „rauen“ Stielen sind – Phillip hatte vor ein paar Tagen einen persönlichen Erstfund – den seltenen Raustiel-Weichritterling (Melanoleuca verrucipes). Namensgebend sind die dunklen, fast schwarzen Schuppen auf dem weißen Stiel.
Der jung angenehm nach Anis oder Bittermandeln – später unangenehm faulig-käseartig – riechende Pilz lebt von faulenden Pflanzen oder Hölzern. Seine Biotope sind gemulchte Beete, mulmige Waldränder, Holzlagerplätze und ehemalige Rindenmulchdeponien.
Der Pilz soll jung essbar sein. Insgesamt wird der Speisewert in der Literatur meist als minderwertig beschrieben – wir sollten ihn aber auch aufgrund seiner Seltenheit schonen.
Catrin

Raustiel-Weichritterlinge (Melanoleuca verrucipes). Ein selten zu findener schöner Pilz.
Foto: Phillip Buchfink
28.07.2025 – Montag

Da ist er – der erste Riesenbovist (Calvatia gigantea)! Das größte je gefundene Exemplar erreichte einen Durchmesser von 150 cm, das schwerste ein Gewicht von 23,3 kg.
Foto: Catrin Berseck
Heute machte ich auf dem Heimweg einen kurzen Stopp in einem klitzekleinen Park. Schon von weitem leuchtete es mir an mehreren Stellen weiß entgegen.
Im nicht gemähten Randbereich fand ich 2 Riesenboviste (Calvatia gigantea). Ein aufgrund seiner Größe kaum verwechselbarer Pilz, der fast jedem Speisepilzsammler als „Schnitzelpilz“ bekannt ist.
Und dann waren da noch einige weiße Pilze, die sich von oben sehr ähnelten und man flüchtig für dieselbe Art halten könnte. Aber man muss sich immer alle Merkmale genau ansehen und auch den Geruch überprüfen.
Es handelt sich zum einen um den essbaren Anis-Egerling (Agaricus arvensis) mit seinen jung blass graulichen, nur schwach rosa Lamellen und einem Geruch nach Anis und Bittermandel.
Dazwischen wuchsen einige Exemplare der giftigen Rosablättrigen Egerlingsschirmlinge (Leucoagaricus leucothites). Die weißlichen Fruchtkörper erinnern an einen Champignon, haben aber weiße und nur im Alter blass rosa gefärbte Lamellen und ein ebenso gefärbtes Sporenpulver. Er riecht und schmeckt schwach pilzartig und wenig auffällig.
Also – immer alle Pilze ganz genau betrachten, bevor sie im Sammelkorb landen.
Catrin

Und hier zwei von oben sich sehr ähnelnde Pilze auf derselben Rasenfläche unweit voneinander entfernt. Aber ein Pilz von oben ist wie ein Käfer von unten…
Foto: Catrin Berseck

Links: Schafchampignon bzw. Gemeiner Anis-Egerling (Agaricus arvensis)
Rechts: Rosablättriger oder Gemeiner Egerlingsschirmling (Leucoagaricus leucothites)
Foto: Catrin Berseck
29.07.2025 – Dienstag

Der 2. Wachstumsschub der Fahlen Röhrlinge (Boletus impolitus) zeigt sich gerade.
Foto: Catrin Berseck
Ich verbringe ja meistens meine Mittagspause bei mir im Gewerbegebiet mit einem kurzen Spaziergang unter einer Eichenkante mit Pappeln und Birken oder in einem nebenan liegendem kleinem Wäldchen.
Also möchte ich euch hier einmal meine „Mittagspausenfunde“ von heute zeigen.
Es lohnt sich tatsächlich für den etwas mehr interessierten Pilzsammler, seine nähere Umgebung regelmäßig auf- und abzusuchen. Man kann viele Erfahrungen über das Pilzwachstum sammeln und merkt auch ganz schnell, wie die Wachstumsschübe bei einzelnen Pilzarten aussehen.
Die Fahlen Röhrlinge habe ich zum Beispiel erst letzes Jahr Ende September entdeckt. Seitdem beobachte diese Stelle und habe bemerkt, dass sie bereits im Juni und jetzt auch im Juli das zweite mal an derselben Stelle Fruchtkörper ausbilden. Und dann auch sicherlich noch ein weiteres mal noch im Herbst…
Die essbaren Perlpilze und giftigen Pantherpilze erscheinen dort auch fast immer zeitgleich in Massen an denselben Stellen nah beieinander. Also ist es in wichtig, diese beiden Pilze sicher voneinander unterscheiden zu können.
Catrin

Einer von ca. 100 Pantherpilzen (Amanita pantherina), die gerade an einer Eichenkante wachsen.
Foto: Catrin Berseck
30.07.2025 – Mittwoch

Gleich zu Beginn unserer Exkursion stimmten uns diese Parasole (Macrolepiota procera) trotz des verkrauteten Waldes wieder hoffnungsvoll.
Foto: Hanjo Herbort
Jeden 2. Mittwoch findet ja unsere Kartierungsexkursion statt. Heute begannen wir ein neues Messtischblatt – das MTB 2135 Zurow im 1. Quadranten.
Keinem von uns war dieses Gebiet bekannt. Wir trafen uns in Zurow und fuhren dann mal auf gut Glück in unser ausgesuchtes Kartierungsgebiet zwischen Fahren und Lübow. Und ehrlich gesagt – wir waren im ersten Moment entsetzt. Wir sahen auf dem schon abenteuerlichen Weg dorthin nur verkrautete und kaum begehbare Wälder…
Aber Kartierung ist nun mal auch in solchen Waldbereichen notwendig – es ging ja nicht um das Sammeln von Speisepilzen.
Und am Ende dieser Exkursion waren wir uns Alle mal wieder einig – trotz Voreingenommenheit war es wieder eine sehr schöne Exkursion mit einigen schönen Funden.
Den ausführlichen Bericht findet ihr hier.
Catrin

Unser heutiges Kartierungsgebiet – einmal rund um den Schmiedesee zwischen Fahren und Lübow.
Foto: Hanjo Herbort
31.07.2025 – Donnerstag
Wie so oft machte ich in meiner Mittagspause einen kleinen Spaziergang an meiner Eichenkante.
Und freute mich im ersten Moment wahnsinnig, direkt am Fuß einer Eiche eine Rotkappe zu erblicken. Direkt an einer Eiche rechnet man ja eigentlich mit einer Eichen-Rotkappe, die ziemlich selten ist.
Aber beim genaueren Betrachten erwies sich diese blasse Rotkappe als Birken-Rotkappe (Leccinum versipelle). Warum? Die Eichen-Rotkappe (Leccinum quercinum) hat rötliche bis rotgraue Schüppchen auf weißem Grund und nicht wie die Birken-Rotkappe schwärzliche Schüppchen. Und die dafür verantwortliche Birke stand 2 Meter daneben. Nichtsdestotrotz ein schöner Fund.
Nach Feierabend besuchte ich dann noch ein anderes parkähnliches Gebiet mit Eichen und habe einige schöne Funde gemacht. Unter anderem viele Sommersteinpilze. Sorry – aber den für einige Speisepilzsammler wichtigsten Pilz überhaupt – habe ich vor Ort vergessen zu fotografieren. Deswegen nur geputzte Pilze – manchmal esse ich ja auch welche…
Catrin

Wie ich bereits geschrieben habe, sind die Mehlräslinge (Clitopilus prunulus) Anzeigerpilze für Steinpilze und Hexenröhrlinge. Hier der Beweis: Direkt neben den Mehl-Räslingen wachsen ganz junge Netzstielige Hexen-Röhrlinge (Suillellus luridus).
Foto: Catrin Berseck

Die Blutroten Filzröhrlinge (Xerocomus rubellus) sind nicht so häufig, wie der Rotfußröhrling zu finden, aber nicht selten.
Foto: Catrin Berseck

Massenweise wachsen jetzt die leicht giftigen Karbolegerlinge (Agaricus xanthoderma).
Foto: Catrin Berseck

Die Sommersteinpilze (Boletus reticulatus) waren entgegen ihrer sonstigen Gewohnheit „unverschämt“ madenfrei.
Foto: Catrin Berseck

Und das hier die anderen Funde für eine Mischpilzpfanne: Frauentäublinge, Schafchampignons, Beutelstäubling, Birkenrotkappe, Blutroter Filzröhrling, Netz- und Flockenstielige Hexenröhrlinge.
Foto: Catrin Berseck
21.06.2025 Öffentliche Wanderung im Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee
Öffentliche Pilzlehrwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
Im Sophienholz zwischen Nevern und Goldebee

Unser heutiges Exkursionsgebiet – das Sophienholz zwischen Nevern, Ravensruh und Goldebee bei herrlichem Sonnenschein.
Foto: Christian Boss
6 Pilzfreunde trafen sich heute in Neukloster an der Tankstelle zur Öffentlichen Wanderung. Wir besuchten das nahegelegene Sophienholz zwischen Nevern und Ravensruh – einem vielseitiges Waldgebiet auf besseren Böden mit vorwiegend Buchen, Fichten aber auch sumpfigen Abschnitten mit Erlenbrüchen.
Im Herbst, mitunter aber auch im Sommer, kann es hier sehr artenreich zugehen. Es handelt sich um einen der interessantesten Wälder im näheren Umfeld Neuklosters.
Unsere Erwartungen hielten sich aufgrund der vorausgegangenen Trockenperiode in Grenzen. Stellenweise war auch nicht ein einziger Pilz zu sehen. Vereinzelt gab es Perlpilze, Graue Wulstlinge und Täublinge. Die waren jedoch teilweise so von den Schnecken zerfressen, dass viele es nicht auf ein Foto schafften.
Allerdings machte uns der Fund des ersten von den Schnecken zerfressenen Sommersteinpilzes Hoffnung. Diese Hoffnung wurde letztendlich auch Wirklichkeit – es gab tatsächlich zu guter Letzt gefüllte Körbe für die Speisepilzsammler.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Täublinge waren heute einige am Start – hier ein grüner Frauentäubling (Russula cyanoxyntha).
Foto: Catrin Berseck

Die ersten Vertreter der Rotfußröhrlinge (Xerocomellus sp.) ließen sich auch endlich blicken.
Foto: Catrin Berseck

Mitten im Wald finden wir den Grabstein des ehemaligen Forstmeisters Carl Regenstein und seiner Familie.
Foto: Catrin Berseck

Daneben dann gleich dieser „Thron“ – der heute aber unbesetzt blieb. Und das aus gutem Grund.
Foto: Catrin Berseck

Auf unserer letzten Vereinsexkursion im Mai 2022 in dieses Gebiet titelte Reinhold dieses Foto so: „Ein Thronsessel für den Chef!“

An diesem bewirtschafteten Platz fanden wir dann auf Sägespänen mehrere Gruppen Rehbrauner Dachpilze (Pluteus cervinus agg.). Ein guter Mischpilz.
Foto: Christian Boss

Ein besonders schönes Exemplar mit dem matt feinfaserigem Hut und den rosa frei stehenden Lamellen. Unter den mitteleuropäischen braunhütigen Dachpilzarten gibt es neben dem sehr häufigen Rehbraunen drei weitere, die nur mikroskopisch voneinander zu unterscheiden sind.
Foto: Christian Boss

An verrotteten Baumstämmen oder Totholz finden wir oft den Breitblättrigen Rübling (Clitocybula platyphylla). Da es nach dem Verzehr gelegentlich zu Magen-Darm Beschwerden kommt, wird dieser Pilz bei der DGfM auf der Liste der Pilze mit uneinheitlich beurteiltem Speisewert geführt und sollte nicht verzehrt werden. Er wird oft mit dem Rehbraunen Dachpilz verwechselt – hat jedoch weiße bis gelbliche Lamellen, die breit ausgebuchtet angewachsen sind.
Foto: Catrin Berseck

Auch Nadelwaldbereiche mit Fichtenbeständen gibt es im Sophienholz. Aufgrund der Trockenheit derzeit kein lohnendes Pilzgebiet.
Foto: Christian Boss

Aber auch einige feuchte Erlenbrüche sind in dem leicht hügeligen Waldgebiet zu finden.
Foto: Christian Boss

Am Wegrand fanden wir dann das Große Hexenkrautes (Circaea lutetiana) mit einem Rostpilz.
Foto: Christian Boss

Es handelt sich um Puccinia circaeae-caricis, der am seltensten von den 3 möglichen Rostpilzen auf diesem Wirt gefunden wird. Zu sehen sind hier die becherförmigen orangegelben Aeziensporenlager mit weißem Rand.
Foto: Christian Boss

Unser Erinnersfoto von der heutigen Wanderung, bevor sich Christian verabschiedete.
Foto: Dorit Meyer

Nachdem Christian gegangen war und 5 Frauen mit einem weniger ausgeprägten Orientierungssinn alleine ließ, machten wir uns langsam ebenfalls auf den Rückweg.
Foto: Catrin Berseck

Und wir wurden beim Suchen nach dem Weg mit einer Gruppe schöner junger Sommersteinpilze (Boletus reticulatus) belohnt!
Foto: Catrin Berseck

Es sah zwar am Anfang nicht so aus – aber am Ende hat sich diese Wanderung für die Speisepilzsammler gelohnt.
Foto: Sylvina Zander
Die Artenliste aus dem Sophienholz zwischen Nevern, Ravensruh und Goldebee im MTB 2135/221 – Zurow
Grauer Wulstling (Amanita excelsa), Perlpiz (Amanita rubescens), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Tintenstrichpilz (Bispora antennara), Sommersteinpilz (Boletus reticulans), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Breitblättriger Holzrübling (Megacollybia platyphylla), Hexenkreut-Rost (Puccina circaeae-caricis), Großer Ampfer-Schilfrost (Puccina phragmatis), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Frauentäubling (Russula cyanoxantha), Dickblättriger Schwärztäubling – alte FK (Russula nigricans), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Geweihförmige Holzkeute (Xylaria hypoxylon)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
18.06.2025 – MTB 2134-2 West- und Ostfriedhof Wismar
Mittwochsexkursion
Messtischblatt Wismar
18. Juni 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2134/2 – Friedhof Wismar

Diese Gruppe Flockenstielieger Hexenröhrlinge (Neoboletus erytrophus) begrüßte uns bereits beim Eintreffen vor dem Friedhofsgelände.
Foto: Christian Boss
Bei angenehmen sommerlichen Temperaturen trafen sich heute 7 Freunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. zu unserer Kartierungsexkursion im 2. Quadranten des Messtischblattes Wismar vor dem Friedhof in Wismar.
Der Friedhof ist eine große als Park angelegte Anlage, die aus dem Westfriedhof, Alten Friedhof und Ostfriedhof besteht. Es wurden dort in der Vergangenheit Baumarten und Zierhecken angepflanzt, die sonst nicht auf natürliche Art und Weise in Mecklenburg-Vorpommern wachsen würden. Das Gelände liegt wie Großteile von Wismar auf lehmigen Geschiebemergel – also guter Boden mit einem hohen Kalkanteil.
Ein ganz besonderes Biotop, wo in der Vergangenheit auch schon besondere und seltene Pilzarten gefunden wurden.
Wir begannen unsere Kartierung auf dem Westfriedhof und wechselten danach auf die andere Straßenseite der Schweriner Straße zum Alten und Ostfriedhof.
Das Pilzaufkommen war erwartungsgemäß nicht so hoch. Aber wir waren alle begeistert von dieser geschichtsträchtigen Anlage mit Ihren Mausoleen und Grabkapellen, Denkmälern und alten Grabanlagen. Unser vielseitig interessierte Naturfreund Chris war wieder mit dabei, so dass wir auch viel über Bäume, Pflanzen und Insekten erfuhren.
Zum Schluss waren wir uns alle einig – es war heute eine der schönsten Exkursionen mit wenigen – dafür einigen seltenen – Pilzarten. Wir wollen euch mit diesen Bildern ein wenig daran teilhaben lassen. Auch wenn es dieses mal nicht nur um Pilze geht, hoffen wir, euch Interessantes und Wissenswertes zu zeigen.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Das Großkelchige Johanniskraut (Hypericum calycinum) blüht am Eingang zum Westfriedhof auffallend schön.
Foto: Christian Boss

Und nicht nur das. Gleich am Eingang des Westfriedhofes stand eine Gruppe Fahler Röhrlinge (Hemileccinum impolitum). Dieser Pilz ist selten und steht auf der roten Liste der gefährdeten Arten.
Foto: Phillip Buchfink

Der Fahle Röhrling hat zitronengelbe Röhren und riecht sehr stark nach Jod (Medizinschrank).
Foto: Phillip Buchfink

Der alte Baumbestand aus verschiedenen Arten und große Rasenflächen sorgen für das parkähnliche Gelände.
Foto: Christian Boss

Die Pyrenäen-Eiche (Quercus pyrenaica) ist eine Pflanzenart aus der Familie der Buchengewächse (Fagaceae). In Parks und Arboreten wird sie gelegentlich als Ziergehölz gepflanzt.
Foto: Christian Boss

Fransige Wulstlinge (Amanita strobiliformis) schieben sich hier aus dem Erdboden. Die Hutoberseite ist mit dicken klebrigen Hüllfetzen besetzt, an denen sich Erde festgesetzt hat. Ansonsten ist die Huthaut glatt.
Foto: Phillip Buchfink

Charakteristisch für den Fransigen Wulstling ist auch das tiefe Wurzeln der Art im Substrat. An der Stielbasis besitzt er eine rübenartig geformte Knolle, die von einer flüchtigen Scheide umgeben ist.
Foto: Phillip Buchfink

Der Gewöhnliche Hornklee (Lotus corniculatus) dient auch als Futterpflanze, Stickstoff-Lieferant und Bienenweide. Die Pflanze enthält Blausäure abspaltende (cyanogene) Verbindungen. Bei Schnecken, den Hauptfeinden des frisch austreibenden Hornklees, wirken sie als Fraßgift.
Foto: Christian Boss

Das fleißig blühende Orangerote Habichtskraut (Hieracium aurantiacum L.) ist eine Wildstaude, die auch als Heilpflanze verwendet wird. Die Wirkung dieses Krautes wird als schleimlösend, harntreibend, antibiotisch, krampflösend und entzündungshemmend beschrieben. In der alten Kräuterkunde wird das Habichtskraut innerlich bei Durchfall, grippalen Infekten, Blasen- und Nierenentzündung, Wurmbefall und Nierensteinen eingesetzt, äußerlich zur Wundbehandlung und als Augenspülung.
Foto: Christian Boss

Die Indische Scheinerdbeere (Potentilla indica) ist eine aus Südostasien und Südasien stammende Pflanzenart, die in Mitteleuropa als Zierpflanze gezogen wird und stellenweise verwildert – so wir hier auf dem Friedhof auch.
Foto: Christian Boss

Ein Netzstieliger Hexen-Röhrling (Suillellus luridus) auf einer Wiese unter Linden.
Foto: Christian Boss

Tränen-Kiefer (Pinus wallichiana). Aufgrund ihres eleganten Aussehens und der lockeren offenen Krone wurde sie in Europa als Zier- und Parkbaum eingeführt.
Foto: Christian Boss

Behaarte Blattstiele der Sommer-Linde (Tilia platyphyllos) – ein wesentlich Unterschied zur Winterlinde.
Foto: Christopher Engelhardt

Wieder wurde etwas gefunden. Voller Einsatz, um die schönste Perspektive für das Foto zu finden…
Foto: Christian Boss

Und hier das Ergebnis: Wieder ein noch junger Fahler Röhrling (Hemileccinum impolitum), der sich neben vielen anderen Exemplaren aus dem moosigen Rasen kämpft.
Foto: Phillip Buchfink
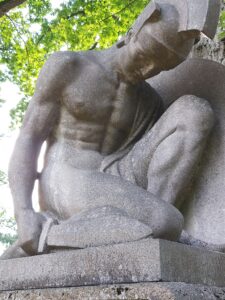
Der Bildhauer Roland Engelhard schuf nach dem Ersten Weltkrieg zahlreiche Kriegerdenkmäler – so auch dieses auf dem Wismarer Friedhof.
Foto: Sylvina Zander

Einer der makroskopisch an seinem doppelten Ring einfach bestimmbaren Vertreter der Champignons. Stadt-Champignons (Agaricus bitorquis).
Foto: Phillip Buchfink

Das Velum und der doppelte Ring des Stadt-Champignons (Agaricus bitorquis) im Detail.
Foto: Phillip Buchfink

Auch diese giftigen Vertreter der Champignons waren bereits am Start. Karbol-Egerling (Agaricus xanthodermus agg.). Für geübte Augen bereits an seinem „Quadratschädel“ zu erkennen. Der Hut ist normalerweise ungeschuppt, kann aber wie hier auch grau oder braun geschuppt sein.
Foto: Christian Boss

Raupensack vom Kleinen Rauch-Sackträger (Psyche casta). Die Raupen des Rauch-Sackträgers spinnen sich eine tragbare Wohnröhre, die sie mit kleinen Stöckchen oder Steinchen bekleben. Beim fertigen Insekt hat nur das Männchen Flügel, das Weibchen lebt weiterhin in dem Gespinnstsack und verlässt ihn nie. Zur Paarung lockt es das Männchen durch einen Duftstoff an und schiebt sich teilweise aus dem Sack. Nach der Paarung legt sie ihre Eier im Gespinnstsack ab und stirbt.
Foto: Christian Boss

Und das hier ist tatsächlich ein Schmetterling, der Hornissen-Glasflügler (Sesia apiformis). Der Hornissen-Glasflügler erinnert mit seiner Warnfärbung und seinem Verhalten potentielle Beutegreifer an Hornissen, die ihn deswegen meiden.
Fotocollage: Christopher Engelhardt

Faltentintling (Coprinopsis atramentaria) am Fuße einer Pappel.
Die Raupen des Hornissen-Glasflüglers leben übrigens vorwiegend im Wurzelbereich von Pappeln und bohren sich in die Rinde ein. Nach 3 bis 4 Jahren verlassen sie gegen Ende ihrer Entwicklung den Baum wieder durch den Fraßgang. Dabei entstehen die links und rechts der Pilze zu sehenden ca. 1 cm großen Austrittslöcher.
Mikroskopische Bestimmung und Foto: Phillip Buchfink

Admiral (Vanessa atalanta). Den Admiral erkennt man an seinen roten Binden auf den Vorder- und Hinterflügeln. Er ist ein „Wandervogel“ unter den Schmetterlingen, denn er fliegt jedes Jahr im Frühling über die Alpen zu uns nach Deutschland. Er ist häufig in Gärten, Wiesen und an Waldrändern anzutreffen.
Foto: Christian Boss

Unser Erinnerungsfoto von dieser wunderschönen interessanten Naturexkursion auf dem Wismarer Friedhof. Von links nach rechts: Phillip, Katarina, Chris, Sylvina, Catrin, Christian.
Foto: Dorit Meyer
Die Artenliste auf dem Friedhof Wismar – MTB 2134/2 NO:
Stadt-Champignon (Agaricus bitorquis), Karbolegerling (Agaricus xanthodermus agg.), Perlpilz (Amanita rubescens), Fransiger Wulstling (Amanita strobiliformis), Angebrannter Rauchpoling (Bjerkandrea adusta), Maipilz (Calocybe gambosa), Faltentintling (Coprinopsis atramentaria), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alter FK (Fomitopsis betulina), Fahler Röhrling (Hemileccinum impolitum), Nelkenschwindling (Marasmius oreades), Flockenstieliger Hexen-Röhrling (Neoboletus erytrophus), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Netzstieliger Hexen-Röhrling (Suillellus luridus)
04.06.2025 – MTB 2134-1 nordöstlich Moorvilla bei Käselow
Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch
04. Juni 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2134/1 – Wald zwischen Käselow und Krönkenhagen nördlich des Moorsees
Heute begannen wir mit der Kartierung des 1. Quadranten des MTB 2134 Wismar. Wir entschieden uns vorher, ein noch nicht besuchtes Waldgebiet zwischen Käselow und und Krönkenhagen aufzusuchen. Es geht ja bei unseren Kartierungen auch darum, nicht oder wenig kartierte Gebiete aufzusuchen, um dort das Pilzvorkommen zu dokumentieren. Außerdem ist es spannend, mal „Neuland“ zu betreten – man weiß ja nicht, was einen erwartet.
Wir wurden mehr als positiv überrascht – es hätte ja auch sein, können, dass wir in einen komplett verkrauteten Wald kommen. Uns erwartete ein Forst auf lehmigem Boden mit vorwiegend lichten Altbuchenbeständen – dazwischen eingestreut, Hainbuchen, Eichen, Spitz- und Bergahorn. Es gab auch einige Nadelholzbereiche mit Fichten.
Wir – das waren 5 Mitglieder der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V., die an diesen sommerlichen Tag auf Erkundungstour gingen.
Catrin – Text, Fotoauswahl und -beschriftung

Wir starten auf diesem Feldweg in den vor uns liegenden Wald zwischen Käselow und Krönkenhagen. Links des Weges liegt der Moorsee.
Foto: Hanjo Herbort

Die 3 Damen der heutigen Wanderung bei sommerlichen Temperaturen auf dem Weg in den Wald.
Foto: Hanjo Herbort

Blick vom Wegesrand auf die Moorsee-Villa. Die direkt am Wegesrand liegenden Feuchtbiotope ließen wir heute mal im wahrsten Sinne des Wortes links liegen. Sie befinden sich außerhalb unseres heutigen Kartierungsgebietes.
Foto: Hanjo Herbort

Der Wald wird auch forstwirtschaftlich genutzt, wie man hier an den zur Abholung gestapelten Fichtenstämmen sehen kann.
Foto: Hanjo Herbort

Gleich zu Beginn unserer Wanderung fanden wir diesen Schuppigen Porling (Polyporus squamosus) an einem Buchenstubben.
Foto: Sylvina Zander

Hier bildet sich gerade ein junger Fruchtkörper des Eichenwirrlings auf einem verrotteten Eichenstamm. Sobald der Fruchtkörper weiter heranreift, brechen einige Porenwände zusammen und bilden dann später die kammerartigen Schlitze mit stumpfen Rippen.
Foto: Catrin Berseck

Die grobe, lamellig-labyrinthische Unterseite eines Eichen-Wirrlings (Daedalea quercina). Der lateinische Gattungsname Daedalea ist eine Anspielung auf die griechische Mythologie. Dädalus war der Baumeister, der das Labyrinth für den Minotaurus baute.
Foto: Christian Boss

Die häufig auf Schnittkanten von Laubholz anzutreffenden Geweihförmigen Holzkeulen (Xylaria hypoxylon) treten sehr formenreich auf – neben der treffenden Bezeichnung „geweihförmig“ können sie auch anders geformt sein. Hier sehen wir junge Exemplare – reif erscheint der Pilz dann schwarz.
Foto: Christian Boss

Hier sehen wir gleich 2 Pilzarten. Ein junges Exemplar des Fichten-Zapfenrüblings (Strobilurus esculentus) und die Fichten-Spaltlippe (Lophodermium piceae) auf Fichtennadeln.
Foto: Christian Boss

Gelbe Lohblüte oder Hexenbutter (Fuligo septica) ist eine Schleimpilz-Art. Was die Hexenbutter so besonders macht – sie kriecht langsam über den Boden oder Holz, auf der Suche nach Nahrung.
Foto: Christian Boss

Hanjo und mir fielen gleich zu Beginn unserer Wanderung diese Buchenbereiche in´s Auge. Mumifizierte Dickblättrige Schwärz-Täublinge (Russula nigricans) waren auf dem Laub verstreut zu finden – Anzeiger, dass in diesen Bereichen auch andere Täublinge, Steinpilze und Hexenröhrlinge vorkommen können.
Foto: Hanjo Herbort

Und da war er dann auch – der erste Täubling. Es handelt sich um den Weißstieligen Ledertäubling (Russula romellii).
Foto: Christian Boss

Was die Bestimmung von Täublingen so schwierig oder aufwendig macht, ist die enorme Farbvariabilität vieler Arten – so auch dieser. Seine Hüte können braun-, wein- oder zinnoberrot, oliv oder ocker, aber auch grün- oder ledergelb gefärbt sein.
Foto: Christian Boss

Deswegen beginnt man bei der Täublingsbestimmung immer mit der Sporenfarbe. Wir haben es hier mit einem milden Dottersporer zu tun. Wichtig sind auch Größe und Habitat bei Täublingen. Der Weißstielige Ledertäubling gehört zu den großen Täublingsarten und wächst bevorzugt bei Rotbuchen.
Foto: Christian Boss

Auch der Frauentäubling (Russula cyanoxantha) zeigt sich mit einer Vielfalt an verschiedenen Hutfarben. Doch egal, in welcher Farbe oder Farbkombination er erscheinen mag – er hat ein Alleinstellungsmerkmal. Es ist der einzige Täubling mit nicht splitternden Lamellen. Die Lamellen des Frauentäublings sind weich und biegsam.
Foto: Christian Boss

Und hier bildet der Zunderschwamm (Fomes fomentarius) auf einer Birke eine „Himmelsleiter“ bis in die Baumkrone.
Foto: Christian Boss

Eine Nacktschnecke lässt sich das Innere eines Hexeneies der Stinkmorchel (Phallus impudicus) schmecken.
Foto: Christian Boss

Tigerschnegel (Limax maximus) gehören zu den Nacktschnecken. Nacktschnecken können Gärtner zur Verzweiflung bringen. Der Tigerschnegel, ein Artgenosse mit Raubkatzen-Print, gehört jedoch überraschenderweise zu den natürlichen Feinden dieser Salaträuber und sollte daher nicht vom Menschen bekämpft werden. Neben totem Pflanzenmaterial und Pilzen stehen auch andere Nacktschnecken auf dem Speiseplan.
Foto: Christian Boss

Pilze aus der Gruppe der Waldfreundrüblinge (Gymnopus). Es gibt sehr viele Varietäten von Waldfreundrüblingen, die ausschließlich mikroskopisch bestimmt werden können. Wahrscheinlich sehen wir hier Hellhütige Waldfreundrüblinge (Gymnopus Aquosus).
Foto: Christian Boss

Es handelt sich wahrscheinlich um den Gelbblättrigen Waldfreundrübling (Gymnopus ocior), der sich durch gelbliche Lamellen auszeichnet und meist büschelig wächst. Er kann mit einigen sehr ähnlichen Arten aus der gleichen Gattung verwechselt werden, wobei die Abgrenzung oft schwierig ist und mikroskopiert werden muss.
Foto: Catrin Berseck

Hier ein Vertreter aus der artenreichen Gattung der Helmlinge (Mycena sp.) auf alten Eichenblättern. Besonders auffällig ist sein extremer langer Stiel mit Mycelfilz an der Steilbasis sowie rosa Farbtönen in den Lamellen.
Foto: Christian Boss

Schwarzblauer Ölkäfer (Meloe proscarabaeus). Die Bezeichnung „Ölkäfer“ geht auf die Fähigkeit dieser Käferfamilie zurück, das Gift Cantharidin zu produzieren. Bei Gefahr lassen Ölkäfer das Gift aus Poren an ihren Beingelenken austreten. Die gelbliche Flüssigkeit erinnert dabei stark an Öltröpfchen. Berührungen der Käfer sollten wegen des Giftes vermieden werden. Nach der Bundesartenschutzverordnung sind alle Arten der Gattung Meloe sowie Sitaris muralis in Deutschland besonders und streng geschützt.
Foto: Christian Boss

Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.). Die Schnecken haben hier bereits die dicht stehenden, durch das Sporenpulver rosagefärbten Lamellen frei gelegt.
Foto: Catrin Berseck

Der Breitblättrige Rübling (Megacollybia platyphylla) wird von Anfängern sehr oft mit dem Rehbraunen Dachpilz verwechselt. Beim genauen Hinsehen erkennt man aber hier aber die weißen bis blass gelblichen, sehr „breit“ ausgebuchtet angewachsen Lamellen. Der Pilz steht bei der DGfM auf der Liste der Giftpilze, da er gastrointestinale Beschwerden auslösen kann.
Foto: Christian Boss
Die Artenliste im Wald zwischen Käselow und Krönkenhagen nördlich des Moorsees – MTB 2134/133
Birnenstäubling – alter FK (Apioperdon pyriforme), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Angebrannter Racuhporling (Bjerkandera adusta), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alter FK (Fomitopsis betulina), Eichenwirrling (Fomitopsis quercina), Gelbe Lohblüte (Fuligo septica), Gelbblättriger Rübling (Gymnopus ocior), Rotbraune Borstenscheibe (Hymenochaete rubiginosa), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Gemeine Stinkmorchel (Phallus impudicus), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Mai-Stielporling (Polayporus ciliatus), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Sklerotienporling (Polporus tuberaster), Frauentäubling (Russuls cyanoxantha), Dickblättriger Schwärztäubling – aler FK (Russula nigricans), Weißstieliger Leder-Täubling (Russula romellii), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Fichtenzapfenrübling (Strobilurus esculentus), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Goldgelber Zitterling (Tremella mesenterica)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
Pilze/Wetter Juni 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im Juni 2025

Ab Mitte Juni kann man bereits die begehrten Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) finden. Auf die Pirsch sollte man am besten nach Regenfällen gehen, da sie dann besonders schön gelb leuchten und leicht zu sehen sind.
01.06.2025 – Sonntag

Ein frischer Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) im Haushalt Forst bei Wiligrad.
Foto: Maria Schramm
Beim sonntäglichen Stromern durch die Haushalt Forst leuchtete schon von weitem ein Schwefelporling in kräftigem Gelb-orange. Er wuchs an einer abgestorbenen, aber noch aufrecht stehenden Eiche, direkt in einer Astgabel, und war gerade noch in Reichweite – zumindest für den Menschen. Für die auch zahlreich anwesenden Schnecken blieb er zum Glück unerreichbar.
Ein paar Stücke konnten noch abgeschnitten werden, bevor das schnell von Südwesten heranziehende Gewitter loslegte.
Das ist im diesjährigen Tagebuch nicht der erste Schwefelporling. Reinhold hat ihn als eine Art Orakelpilz betrachtet. Er hat nämlich beobachtet, dass in den Jahren, in denen es im Frühling viele Schwefelporlinge gab, der Rest des Pilzjahres nicht so üppig ausfiel.
Wir werden sehen.
Die zartesten Stückchen dieses Schwefelporlings wurden zu kleinen Schnitzeln verarbeitet. Ein herb-säuerlicher Geschmack, von der Eiche herstammend, konnte nicht festgestellt werden. Der Geschmack war mild und angenehm, die Textur fest und die Farbe hellgelb und sogar leicht rosa. Wichtig ist, die Schnitzelchen auf niedriger Flamme lange braten zu lassen, damit die Pilzstücke auch gut durchgegart sind.
Maria
02.06.2025 – Montag

Tintlinge (Coprinellus sp.) gehören mit zu den ersten Pilzen, die man nach ausgiebigen Regenfällen antreffen kann. Der Pilz lebt als Saprobiont an morschem Holz.
Foto: Catrin Berseck
Der Regen der letzten Tage und die warmen Temperaturen zeigen jetzt langsam an der Pilzfront im wahrsten Sinne des Wortes die ersten Früchte.
Hanjo und ich waren an unterschiedlichen Stellen im Bützower Raum unterwegs, um das Pilzwachstum zu checken. Es zeigen sich so langsam einzelne Pilze verschiedener Gattungen, so dass man auch schon mal eine kleine Mahlzeit zusammen bekommt.
Alles in allem werden die Niederschläge und das ständig warme Wetter einiges an der Pilzfront bewirken, aber es gilt zu bedenken, wir haben erst Anfang Juni und nicht Ende August!
Am 25.05.2025 gab es erst die für das Pilzwachstum auslösenden Niederschläge. In den nächsten Tagen dürften Flockenstielige Hexenröhrlinge, Sommersteinpilze sowie Täublinge zulegen.
Hier schon mal einige Funde von heute aus dem Bützower Raum.
Catrin und Hanjo

Diese Frauentäublinge (Russula cyanoxantha) reichen bereits für eine kleine Pilzmahlzeit.
Foto: Hanjo Herbort

Auch die Ackerlinge (Agrocybe sp.) lassen sich bereits blicken. Als Saprobionten ernähren sie sich von abgestorbenem Pflanzengewebe. Die Fruchtkörper sind deshalb meist auf den namensgebenden Äckern, Wiesen, Parkflächen, Komposthaufen oder seltener auf Totholz zu finden.
Foto: Hanjo Herbort

Die Maipilze (Calocybe gambosa) starten nach den Regenfällen stellenweise noch mal durch.
Foto: Catrin Berseck

Der erste Gold-Röhrling bzw. Lärchen-Röhrling (Suillus grevillei) hat den Schnecken geschmeckt. Wie der Name schon verrät – ein Mykorrhiza-Pilz (Symbiosepilz) der Lärche.
Foto: Catrin Berseck

Die Schnecken machen derzeit vor nichts halt – selbst Hexeneier der Stinkmorchel (Phallus impudicus) werden verspeist.
Foto: Hanjo Herbort

Die vor einer Woche bereits gezeigten jungen fast noch weißen Kastanienbraunen Stielporlinge (Picipes badius) haben nun ihre namensgebende Farbe erhalten. Nicht mehr lange – die Schnecken lassen sich auch diese schmecken.
Foto: Hanjo Herbort

Ein Rehkitz im Laub gut getarnt. In der Brut- und Setzzeit (01.04. – 15.07.) sind wir dazu angehalten, uns im Wald ruhig zu verhalten, möglichst auf den Wegen zu bleiben, Hunde an der Leine zu führen und Flora und Fauna so weit wie möglich unberührt zu lassen. Falls Ihr – so wie hier einem Rehkitz begegnet – bitte nicht berühren und sich schnellstmöglich entfernen.
Foto: Hanjo Herbort

Nach der Pilzsuche ging es dann für Hanjo noch zu seinem weiteren Hobby – dem Angeln. Dabei konnte er diesen schönen Regenbogen an der Warnow bei Rühn im Bild festhalten. Petri Heil – hoffentlich so erfolgreich wie bei den Pilzen heute. Nachtrag: Kein einziger Biss – das Glück war wohl bei den Pilzfunden schon ausgeschöpft…
Foto: Hanjo Herbort
03.06.2025 – Dienstag
Erst einmal zum Wetter.
Ab morgen droht eine brisante Unwetterlage in Deutschland. Bereits in der Nacht auf Mittwoch kommt es in Bayern und Baden-Württemberg zu ersten kräftigen Gewittern, die jedoch noch nicht das volle Ausmaß erreichen. Am Morgen beruhigt sich das Wetter kurzzeitig, doch bereits im Laufe des Vormittags setzt im Süden erneut intensiver Regen ein. Im Tagesverlauf drohen Starkregen mit bis zu 30 Litern pro Quadratmeter, Hagelkörner von bis zu acht Zentimetern Durchmesser und Orkanböen von bis zu 130 km/h.
Mecklenburg-Vorpommern soll dieses Unwetter nicht erreichen – es ist ein Wechsel aus Sonne und Wolken angesagt – mit vereinzelten möglichen Regenschauern.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Da das vorhergesagte Unwetter Mecklenburg-Vorpommern verschonen soll, sollte unserer morgigen Kartierungsexkursion auch nichts im Wege stehen…
Siehe unter Termine .
Dieses Foto möchte ich euch auf keinen Fall vorenthalten. Irina hat gestern in Rostock in der Gartenstadt diesen wunderschönen Netzstieligen Hexenröhrling (Suillellus luridus) inmitten eines Blumenbeetes gefunden.
Sehr schön ist hier auf dem Stiel die rötliche Netzzeichnung auf gelblichem Grund zu sehen, der der Pilz auch seinen Namen zu verdanken hat. Der Hut ist lederfarben bzw. graubraun mit Olivtönen gefärbt.
Der Pilz gehört zu den Speisepilzen – ist roh bzw. unzureichend gegart jedoch giftig.
Leider wird man selten Exemplare finden, die nicht von den Maden heimgesucht wurden.
Catrin
04.06.2025 -Mittwoch
Heute trafen sich 5 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. wieder zu einer Kartierungsexkursion. Dieses mal war der 1. Quadrant des Messtischblattes 2134 Wismar an der Reihe.
Wir besuchten ein komplett unbekanntes Waldstück in der Nähe von Käselow nordöstlich der Moorvilla. Und wir wurden positiv überrascht! Uns erwartete ein Laubmischwald auf lehmigem Boden, der hauptsächlich aus Altbuchen und -eichen bestand – ein sogenannter „Hexenkraut-Waldmeister-Buchenwald“. Dazwischen Abschnitte mit Fichten – eingestreut Douglasien, Eschen und Ahorn.
Zu gegebener Zeit sicherlich ein Paradies für Speisepilzsammler! Aber auch heute fanden wir einige Täublingsarten und weitere interessante Pilze.
Den kompletten Bericht von dieser Exkursion findet ihr hier .
Catrin
07.06.2025 – Sonnabend

Weißstieliger Leder-Täubling (Russula romellii). Er kann mit dem dem Braunen Ledertäubling (Russula integra) verwechselt werden, der jedoch im Nadelwald wächst.
Foto: Hanjo Herbort
Hanjo und ich waren unabhängig voneinander in unseren Buchenwäldern unterwegs – unterschiedlich lange und mit unterschiedlicher Ausbeute.
Hanjo legte immerhin 5 km Strecke zurück, um sich über das derzeitige Pilzaufkommen zu informieren und wenigstens ein paar Pilze für die Pfanne zu finden.
Ich begnügte mich einer kurzen halbstündigen Erkundungstour und war etwas enttäuscht. Ich hätte wenigstens damit gerechnet, dass nach dem vielen Regen wenigstens ein paar Schwindlinge, Tintlinge oder Ähnliches zu finden sind. Jedoch fast gähnende Leere – bis auf eine Stinkmorchel, die mir ihren „Stinkefinger“ zeigte…
Es wird wohl noch bis Ende des Monats dauern, bis die Niederschläge greifen und das Pilzwachstum in unseren Wäldern voll in Gang kommt.
Hier trotzdem ein paar Funde – natürlich hauptsächlich von Hanjos Tour.
Hanjo und Catrin

Die ersten Grauen Wulstlinge (Amanita excelsa). Merkmale sind die knollig verdickte Stielbasis, die geriefte Manschette und grobschollige gräuliche Flocken auf dem Stiel. Er ähnelt vom Habitus dem Perlpilz – rötet aber bei Verletzung nicht. Die Verwechslungsmöglichkeit des Grauen Wulstlings mit dem Pantherpilz (Amanita pantherina) ist enorm und hat schon zu zahlreichen Vergiftungen geführt.
Foto: Hanjo Herbort

Die Schnecken lassen von den Lungen-Seitlingen (Pleurotus pulmonarius) kaum etwas übrig.
Foto: Hanjo Herbort

Auch diesen Rehbraunen Dachpilz (Pluteus cervinus agg.) lässt sich diese Schnecke schmecken.
Foto: Hanjo Herbort

Stinkmorchel (Phallus impudicus) mit der olivgrünen schleimigen Gleba (Fruchtschicht). Sie strömt einen intensiven Aasgeruch aus, wodurch Fliegen angelockt werden. Diese nehmen in wenigen Stunden die Gleba vollständig auf und verbreiten so die Sporen des Pilzes.
Foto: Hanjo Herbort

Innerhalb von ein paar Stunden ist die Gleba weg – zurück bleibt ein weißes Gebilde, das im Volksmund als „Leichenfinger“ bezeichnet wird. Der Pilz wächst oft aus Grabhügeln – so entstand der Aberglaube, dass der darunterliegende Tote ein sündiges Leben führte. Als Warnzeichen wächst nun sein stinkender Finger heraus, der alle vor seinen bösen Taten warnen soll.
Foto: Catrin Berseck

Glimmertintlinge (Coprinellus micaceus agg.) gehören zur Gattung der Flockentintlinge (Coprinellus), deren Hüte durch aufliegende Glimmerschüppchen bereift erscheinen. Einige Arten dieser Gattung sind nur schwer auseinanderzuhalten. Typisch ist das büschelige Wachstum. Die Bestimmung des Glimmertintlings ist allerdings gar nicht so einfach, denn es gibt ein paar sehr ähnlich aussehende Arten.
Foto: Hanjo Herbort

Der Gold-Mistpilz (Bolbitius titubans) kann wegen seiner auffallend goldgelben Farbe kaum verwechselt werden. Er wächst einzeln bis gesellig auf gedüngten Böden und an nährstoffreichen Standorten.
Foto: Hanjo Herbort
08.06.2025 – Pfingstsonntag

Halsband-Schwindlinge (Marasmius rotula) sind meist die ersten Pilze, die man nach Regenfällen findet. Den Namen Halsbandschwindling tragen sie, weil ihre schmalen, etwas entfernt stehenden Lamellen miteinander verwachsen sind ohne den Stiel zu erreichen. Sie bilden hier eine Art Ring, Kragen oder Halsband, was in der Pilzkunde Kollar genannt wird.
Foto: Catrin Berseck
Nachdem es bereits seit Donnerstag fast flächendeckend bei uns in Mecklenburg-Vorpommern mehr oder weniger regnet, nutzte ich am heutigen Feiertag nachmittags eine Niederschlagspause, um einen Spaziergang zu machen.
Nachdem ich gestern im Wald ziemlich enttäuscht wurde, waren dieses mal Rasenflächen in Parkanlagen und Wiesen mein Ziel. Erfahrungsgemäß wachsen dort die Pilze nach mehrtägigen Regenfällen eher.
Und dieses mal sollte ich auch nicht enttäuscht werden.
Catrin

Auch die Waldfreunrüblinge (Gymnopus dryophilus) zeigen sich endlich. Dryophilus bedeutet „baumliebend“, in etwa gleichzusetzen mit „Freund des Waldes“.
Foto: Catrin Berseck

Und auch die ersten Vertreter der Stäublinge bzw. Boviste zeigen sich bereits. Hier der Hasen- bzw. Getäfelter Stäubling (Lycoperdon utriforme) – gekennzeichnet durch seine meist deutlich spitzkegeligen Erhebungen und später felderig aufreißende äußere Fruchthülle.
Foto: Catrin Berseck

Hier wuchsen im Hexenring ganz frische Nelken-Schwindlinge (Marasmius oreades). Der Geruch erinnert etwas an Gewürznelken – daher der Name.
Foto: Catrin Berseck

Zwischen den Nelken-Schwindlingen wuchs eine Vielzahl an Halbkugeligen Ackerlingen (Agrocybe semiorbicularis). Dieser kleine Ackerling ist häufig ab Mai nach Regenfällen auf Wiesen und grasigen Wegrändern zu finden.
Foto: Catrin Berseck

Ein weiterer Vertreter der Ackerlinge ist der Weiße bzw. Rissige Ackerling (Agrocybe dura). Der weißliche, anfangs glatte Hut, reißt später felderig auf. Die zunächst blassen Lamellen verfärben sich bald tabakbräunlich.
Foto: Catrin Berseck

Dieses mal sind es aber Maipilze (Calocybe gambosa), die es im Mai aufgrund der Trockenheit kaum zu sehen gab und die jetzt im Juni nach den Regenfällen an einigen Stellen noch fruktifizieren.
Foto: Catrin Berseck

Weitere Vertreter aus den hexenringbildenenden Pilzen gab es dann auch schon – Wiesenchampignons (Agaricus camprestis).
Foto: Catrin Berseck
09.06.2025 – Pfingstmontag
Heute will ich nur mal zeigen, was aus meinen gesammelten Wiesenpilzen von gestern geworden ist…
Catrin

Ravioli gefüllt mit Steinpilzen mit Rahmsoße aus den Maipilzen und paniertem Hasenstäubling.
Foto: Catrin Berseck
10.06.2025 – Dienstag
Heute war eigentlich eine private Exkursion mit den Schweriner Botanikern auf die Insel Kaninchenwerder im Schweriner See geplant. Aufgrund des anhaltenden Regens mussten wir diese heute morgen leider kurzfristig absagen.
Nichtsdestotrotz erreichten mich heute gleich zwei schöne Nachrichten.
Andreas Herchenbach hat in Wismar tatsächlich den ersten Sommersteinpilz der Saison gefunden. Damit hat sich der interne Wettbewerb zwischen mir und Hanjo diesbezüglich erledigt – der Gewinner ist eindeutig Andreas!
Und dann hat sich Wilhelm Schulz bei uns per E-Mail gemeldet. Als Naturfotograf aus der Nähe von Duisburg ist er der Urheber vieler schöner Fotos auf dieser Website. Ihr könnt einige seiner Fotos unter der Kategorie Schöne Pilzfotos bewundern – links in der Kategorieleiste findet ihr 7 Beiträge dazu. Viele andere Fotos von ihm hat Reinhold in seine Beiträge eingearbeitet.

Dieses Foto bekam ich heute per E-Mail von Wilhelm Schulz. Stadt-Champignon (Agaricus bitorquis) zwischen Hauswand und Gehweg am 14.05.2023… Der Pilz ist in der Lage, durch Schotter und selbst Asphaltdecken zu brechen.
Foto: Wilhelm Schulz
Ich hatte nachmittags noch einen Termin bei Satow und habe mich dort mal umgesehen und einiges gefunden. Wieder in Parkanlagen und auf Grasflächen.
Catrin

Und welch Zufall – Stadt-Champignons gab es in Satow sehr viele! Einer der wenigen Champignonarten, die man aufgrund des recht harten Fleisches und dem doppelten und nach unten abziehbaren Stielring einfach erkennen kann.
Foto: Catrin Berseck

So sehen die kleinen „Schmutzfinken“ aus, wenn sie sich aus dem nassen Erdreich an die Oberfläche begeben. Meist kommen die Stadt-Champignons nie vollständig heraus – der größte Teil des Pilzes bleibt im Erdboden.
Foto: Catrin Berseck

Im ersten Moment hätte man sie von oben und aufgrund Ihrer Größe für Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) halten können…
Foto: Catrin Berseck

… Aber der Blick auf die Unterseite enttarnte sie als Gallertfleischige Stummelfüßchen (Crepidotus mollis) mit braunem Sporenpulver. Einer der wenigen Pilze aus dieser Gattung, der durch seine abziehbare und gummiartig dehnbare Huthaut makroskopisch zu bestimmen ist.
Foto: Catrin Berseck

Scheinbar auf dem Erdboden wachsen diese Grünblättrigen Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare). Er wächst jedoch nur an Totholz, welches hier wahrscheinlich vergraben unter dem Gras ist.
Foto: Catrin Berseck

Hier noch Gelbblättrige Rüblinge (Gymnopus ocior) mit den dunklen rotbraunen Hüten, gelbbraunem faserig brechendem Stiel und blassgelben Lamellen.
Foto: Catrin Berseck
11.06.2025 – Mittwoch
Heute stattete ich nach Feierabend mal meiner ehemaligen Heimatstadt Güstrow einen Besuch ab und machte einen Spaziergang am Inselsee.
Wie der fleißige Tagebuchleser sicherlich bereits gemerkt hat, ist die Suche nach Pilzen auf Wiesen, in Parkanlagen und ähnlichen Gebieten derzeit erfolgreicher als in den Wäldern.
Das sollte auch heute wieder so sein. Ich habe mich über einige neu erschienene Arten gefreut. Natürlich auch über meinen ersten Sommersteinpilz dieses Jahr…
Catrin

Hier sehen wir noch einmal den Perlpilz, wie er sich aus aus dem sandigen Boden nach oben kämpft.
Foto: Catrin Berseck

Und wie es der Zufall so will – ca. 3 Meter daneben wuchs einer der giftigen Verwechslungspartner – der Pantherpilz (Amanita pantherina).
Foto: Catrin Berseck

Im Vergleich die zu sehenden Unterscheidungsmerkmale:
Pantherpilz (links) mit dem konzentrisch angeordnet und reinweißlich gefärbten Flocken und dem „Bergsteigersöckchen“, das den Stiel relativ hart in Stiel und Stielknolle unterteilt. Der Perlpilz (rechts) mit den grauen Flocken auf dem Hut und der rübenartigen Knolle, die an der Verletzungsstelle rötlich verfärbt ist.
Foto: Catrin Berseck

Ein kleiner junger Fruchtkörper des Wiesen-Stäublings mit vergänglichen, mehrteiligen Stacheln in der Nahaufnahme.
Foto: Catrin Berseck

Und auch die Täublinge waren bereits am Start. Hier Starkriechende Herings-Täublinge (Russula graveolens) unter Eiche.
Foto: Catrin Berseck

Einen ca. walnußgroßen Sommersteinpilz (Boletus reticulatus) gab es auch schon. Der darf natürlich weiter wachsen und ist vor Ort geblieben.
Foto: Catrin Berseck
12.06.2025 – Donnerstag

Junge Zunderschwämme (Fomes fomentarius) heute von Vera und Wilfried im Urwald auf Schelfwerder im Bild festgehalten.
Foto: Wilfried Holtz
Unsere Vereinsmitglieder Wilfried und Vera waren heute auf Schelfwerder unterwegs und haben neben anderen Pilzen auch einige Speisepilze finden können.
Da aus den südlichen Bundesländern und Brandenburg bereits viele Pfifferlingsfunde gemeldet werden, habe ich mich mal in die Nossentiner/Schwinzer Heide im Landkreis Güstrow begeben. Die dortigen Kiefern- und Jungeichenwälder auf sandigen Böden sind das ideale Habitat für die sogenannten „Eierschwämme“.
Ich ahnte es bereits im Vorfeld – bei uns in Mecklenburg/Vorpommern wird es noch etwa bis ca. Ende des Monats dauern, bis sich die begehrten Speisepilze zeigen werden. An den mir bekannten Stellen war jedenfalls noch nichts zu sehen.
Aber man findet ja trotzdem immer irgend etwas oder hat wenigestens einen schönen Spaziergang in der Natur gemacht…
Catrin

Wilfried und Vera haben hier ihren ersten Perlpilz (Amanita rubescens) in dieser Saison gefunden.
Foto: Wilfried Holtz

Aber auch frische Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) waren auf Schelfwerder zu finden.
Foto: Wilfried Holtz

Immer wieder mit seiner leuchtend gelben Farbe schön anzusehen – der Gold-Mistpilz (Bolbitius titubans) auf seinem typischen Substrat von Pflanzenresten.
Foto: Catrin Berseck

Mastige Spindelige Rüblinge (Gymnopus fusipes) unter einer Eiche. Ein leicht zu erkennender Vertreter seiner Gattung. Der Hut ist fleischbraun bis dunkel rotbraun gefärbt – die Stiele sind nach unten verdreht, spindelig verjüngt und wurzeln im Substrat. Das Myzel reicht bis an höher liegende Hauptwurzeln seines Wirtsbaumes. Zumeist wächst er an Eichenstümpfen oder an den Füßen größerer, gesunder und lebender Eichen – so wie auch hier.
Foto: Catrin Berseck

Die Schopf-Tintlinge (Coprinus comatus), auch Spargelpilz genannt, starten jetzt auch langsam durch. Es handelt sich um eine Pilzart aus der Familie der Champignonverwandten.
Foto: Catrin Berseck
13.06.2025 – Freitag

Ausgewachsene Flockenstielige Hexenröhrlinge (Neoboletus luridiformis) heute in einer Parkanlage.
Foto: Catrin Berseck
Freitag, der 13. soll ja laut Aberglaube eigentlich ein Unglückstag sein.
Jesus wurde der Überlieferung nach an einem Freitag gekreuzigt und der Apostel Judas Iskariot, der Jesus gegen 30 Silberlinge verraten hat, war der 13. in der Runde beim letzten Abendmahl…
Da ich nicht abergläubisch bin, war es für mich heute ein Glückstag – so wie die 13 in anderen Kulturen auch eine Glückszahl ist.
Bei meinem Feierabendspaziergang konnte ich heute Massen an Flockenstieligen Hexenröhrlingen (Neoboletus luridiformis) finden. Nicht im Wald, sondern in Parkanlagen. Viele waren noch sehr klein und sind natürlich auch vor Ort verblieben. Auch ein Netzstieliger Hexenröhrling (Suillellus luridus) war dabei.
Es war schön zu sehen, dass das Pilzwachstum nach den Regenfällen endlich so langsam in Gang kommt.
Zwei kleine Wermutstropfen war dennoch dabei – es war fast die einzige Pilzart, die ich außer ein paar vertrockneten Dachpilzen gesehen habe. Und die jungen Hexenröhrlinge haben aufgrund der sommerlichen Temperaturen bereits leichte Trockenschäden.
Catrin

Diese kleine zum Teil verwachsene Hexenfamilie durfte natürlich an Ort und Stelle verbleiben.
Foto: Catrin Berseck

Netzstieliger Hexenröhrling (Suillellus luridus) und Flockenstieliger Hexenröhrling (Neoboletus luridiformis) im Vergleich.
Foto: Catrin Berseck
14.06.2025 – Sonnabend
Nachdem Catrin die letzten Tage kräftig mit Röhrlings-, Wulstlings- und Täublingsfunden aus Parks der weiteren Umgebung vorgelegt hat – ich aber nicht so weit fahren wollte – nahm ich mir zunächst eine lange Eichenkante in der Nähe vor, die zumindest einen ähnlichen Charakter bietet.
Aber außer zwei Vertretern der Faltentintlinge war hier nichts zu holen.
Also ging es dann doch wieder in den nahen Buchenwald und aus einer geplanten kleinen Runde wurde dann schnell wieder ein 5 Kilometer Fußmarsch an mir bekannte wärmebegünstigte Standorte. Immer in der Hoffnung auf den ersten Sommersteinpilz oder wenigstens einen Hexenröhrling…
Auch wenn es sehr mühsam war, hier und da gab es einen Frauentäubling oder Sklerotienporling. Zuletzt war noch ein Dreiergespann Graue Wulstlinge zu finden. Alles in allem nach wie vor sehr spärlich – aber wer suchet, der findet. Zwar keine Raritäten – aber wenigstens durchaus etwas für die Pfanne.
Hanjo
15.06.2025 – Sonntag
In Schwerin fand dieses Wochenende das Historische Schlossfest statt. Ein Grund für mich, am Sonnabend mal unsere Landeshauptstadt zu besuchen.
Natürlich habe ich dabei vor Ort auch einen Spaziergang durch den Schweriner Schlossgarten und die angrenzende mehrteilige Parkanlage gemacht. Im Schlossgarten und den umliegenden Parkanlagen finden wir hauptsächlich Linden, Eichen, Buchen und Kastanien.
Auch hier hat das Pilzwachstum schon begonnen. Die Sommersteinpilze zeigen sich bereits – aufgrund der Hitze mit Trockenschäden. Aber auch Netzstielige Hexenröhrlinge und Täublinge waren zu finden.
Von Andreas Okrent bekam ich dann noch die Nachricht, dass gestern sogar bereits die ersten Gemeinen Steinpilze im Rostocker Raum gefunden wurden.
Catrin

Die ersten Gemeinen Steinpilze (Boletus edulis) wurden auch schon am 14.06.2025 in der Rostocker Heide gefunden.
Foto: Andreas Okrent

Die Netzstieligen Hexenröhrlinge (Suillellus luridus) waren im Schlosspark Schwerin an vielen Stellen anzutreffen.
Foto: Catrin Berseck
16.06.2025 – Montag
Sonntag war ich nachmittags kurz vor dem Regen noch mal in der näheren Umgebung unterwegs.
Zuerst suchte ich eine Stelle auf, wo ich Netzstielige Hexenröhrlinge vermutete. Die waren auch vor Ort – wie immer völlig vermadet.
Aber um so mehr freute ich mich, dass ich dort tatsächlich noch Ziegelrote Risspilze (Inocybe erubescens) fand. Sie wachsen hauptsächlich im Mai – so wie auch der Maipilz (Calocaybe gambosa) und viele Champignonarten (Agaricus sp.).
In der Literatur wird immer wieder die Verwechslungsgefahr mit Maipilzen und mit weißhütigen Champignons betont. Doch bei sorgfältiger Beachtung der Merkmale sollte das auch dann nicht vorkommen, wenn die jungen Ziegelroten Risspilze sich noch nicht rötlich verfärbt haben. Vor allem die radialfaserige, zum Einreißen neigende Huthaut ist ein gutes Merkmal, das die angeblichen Verwechslungsarten nicht haben.
Der Ziegelrote Risspilz gilt als tödlich giftig – je nach Muscaringehalt ist die tödliche Menge in 40 bis 500 Gramm Frischpilz enthalten.
Catrin

Ziegelroter Risspilz bzw. Mai-Risspilz (Inosperma erubescens). Er erscheint vor allem in Parkanlagen, unter Gebüsch und in Rasenflächen auf kalkhaltigen Böden vor allem bei Buchen und Linden von Ende Mai bis Anfang Juli.
Foto: Catrin Berseck

Hier ein junger Ziegelroter Risspilz – noch ohne die roten Verfärbungen. Wenn man aber genau hinsieht, kann man bereits den rosa Schimmer in den Lamellen erkennen.
Foto: Catrin Berseck

Auch frische Maipilze (Calocybe gambosa) gab es tatsächlich noch. Allerdings von den allgegenwärtigen Schnecken bereits angefressen.
Foto: Catrin Berseck

Auf nassem Totholz findet man oft diese wunderschönen Schleimpilze – Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum).
Foto: Catrin Berseck

Bei jungen Fruchtkörpern tritt bei Verletzung der Cortex die namensgebende rötliche Milch aus.
Foto: Catrin Berseck
17.06.2025 – Dienstag

Und da sind sie – die ersten Pfifferlinge (Cantharellus cibarius)! Von Andreas Okrent am 16.06.2025 am Waldrand auf dem Weg zur Arbeit gefunden.
Foto: Andreas Okrent
Am Sonntag besuchte ich auf dem Nachhauseweg noch kurz meinem Hauswald. Ein schöner Mischwald mit alten Buchen und Fichten auf lehmigem Boden. Es ist übrigens der Wald, den ich mir mit Hanjo „teile“ – allerdings gehe ich immer von der anderen Seite dort hin.
Da Hanjo ja richtig Strecke machten musste, um fündig zu werden, habe ich mir auch nicht so viel versprochen. Aber es kommt ja immer anders, als man denkt…
Kaum hatte ich den Wald betreten, standen bereits die ersten Täublinge vor mir. Aufgrund der Hitze und Trockenheit hielten sich die Schnecken heute mächtig zurück – wahrscheinlich hatten sie sich irgendwo im Laub verkrochen.
Und gestern machte ich während der Mittagspause auf der Arbeit meinen üblichen Spaziergang und fand tatsächlich schon die erste Rotkappe.
Und Andreas Okrent meldete den ersten Pfifferlingsfund bei uns.
Catrin

Die Farbenvielfalt der Frauentäublinge (Russula cyanoxantha). Die Hutfarben variieren von grün, braun, blau bis lila.
Foto: Catrin Berseck

Hainbuchenraufußröhrling ( (Leccinellum pseudoscabrum). Wie der Name schon sagt – ausschließlich unter Hainbuchen zu finden. Zu erkennen auch an der grauvioletten Verfärbung des Stiels.
Foto: Catrin Berseck

Hier ganz junge Hainbuchenraufußröhlinge. Der Hut der ist wie gehämmert (runzelig). Auf dem weißlichen Stiel erkennt man jetzt schon die braunschwarzen bis grauschwarzen Schüppchen.
Foto: Catrin Berseck

Ein weiterer Vertreter der Raufußröhrlinge. Standorttreu wie jedes Jahr zeigt sich wieder die Espenrotkappe (Leccinum aurantiacum) an bekannter Stelle auf einem Grünstreifen im Gewerbegebiet. Wie der Name schon verrät, ist es ein Mykorrhiza-Pilz der Espe und kommt ausschließlich unter Zitterpappeln vor.
Foto: Catrin Berseck

Fichtenspargel (Monotropa hypopitys) – eine Seltenheit in unserer heimischen Natur. Die kleine blattlose Pflanze gehört zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae) und besitzt überhaupt kein Chlorophyll und kann keine Photosynthese betreiben. Als Epiparasit holt er sich seine Nährstoffe aus dem Hyphengeflecht von Mykorrhiza-Pilzen in seinem Wurzelbereich, in dem er das Pilzgeflecht einfach „anzapft“.
Foto: Catrin Berseck
18.06.2025 – Mittwoch

Ein Fransiger Wulstling (Amanita strobiliformis) auf dem Wismarer Westfriedhof in Szene gesetzt.
Foto: Sylvina Zander
Am heutigen Mittwoch stand wieder eine Kartierungsexkursion auf dem Plan, zu der sich 7 Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. trafen.
Der 2. Quadrant des Messtischblattes Wismar war an der Reihe und wir besuchten den als Gartendenkmal unter Denkmalschutz stehenden Friedhof in Wismar Süd. Der ab 1832 angelegte parkartige Friedhof mit einem gut erhaltenen alten Baumbestand besteht aus dem Alten Friedhof, dem Ost- und dem Westfriedhof.
Der Friedhof ist ein sehr interessanter Ort, auf dem auch regelmäßig durch den Verein zur Förderung der Friedhofskultur Wismar e.V. neben Veranstaltungen zur Geschichte des Friedhofes auch Führungen zur Pflanzen- und Vogelwelt angeboten werden.
Wir waren heute hier natürlich hauptsächlich wegen den Pilzen unterwegs, haben uns aber auch mit den dort vorkommenden Bäumen, Pflanzen und Insekten beschäftigt.
Obwohl die Artenvielfalt bei den Pilzen noch sehr zu wünschen ließ, konnten wir dennoch sehr schöne und auch seltenere Pilzfunde in unsere Kartierungsdatei aufnehmen. Dazu gehörten z.B. Fransige Wulstlinge und Fahle Röhrlinge. Auch Vertreter der Champignons zeigten sich bereits an mehreren Stellen.
Den kompletten Bericht von dieser Exkursion findet ihr demnächst hier .
Catrin
19.06.2025 – Donnerstag
Heute war ich mal kurz auf Hanjo´s Seite von unserem Wald gucken. Ich musste ja prüfen, ob Hanjo eventuell eine stärkere Brille braucht. (^_~)
Braucht er definitiv nicht… Es ist dort tatsächlich fast pilzleer – obwohl Luftlinie nur ca. 3 km von meinem Bereich entfernt. Nach nur 20 Minuten habe ich mich sofort auf meine Seite des Waldes begeben.
Ich habe aber vorher noch großzügigerweise meine Putzreste von den Flockenstieligen Hexenröhrlingen und Täublingen bei ihm verteilt – damit er in Zukunft dort auch mehr findet. (^_^)
Kaum war ich in „meinem“ Waldstück angekommen, sah die Pilzwelt schon wieder ganz anders aus. Immer noch viele Frauen- und Papageientäublinge, die Hainbuchenraufüße sind massenweise erschienen und zu guter letzt habe ich im tiefen Buchenlaub noch einige Sommersteinpilze gefunden.
Catrin

Der blasse hellbraune Stiel ist bei jungen Exemplaren zunächst bauchig-knollig und streckt sich bald walzenförmig. Er ist arttypisch mit einem Netz von gestreckten Maschen aus erhabenen, hellen, weißlichen Adern gekennzeichnet, das sich bis in die unter Stielhälfte und nicht selten auch über den ganzen Stiel erstreckt.
Foto: Catrin Berseck

Hainbuchenraufüße (Leccinellum pseudoscabrum) mit seinem grubig-runzeligem karamellfarbenem Hut und seinen schwarzbräunlichen Schuppen am Stiel. Das Fleisch verfärbt nach Verletzung oder Anschnitt grauviolett und wird nach kurzer Zeit schwarz.
Foto: Catrin Berseck
20.06.2025 – Freitag

Tränende Saumpilze (Lacrymaria lacrymabunda) sind als Saprobiont recht häufig an grasigen Wald- und Waldwegrändern, auf Äckern, Wiesen, in Parkanlagen und Gärten zu finden.
Foto: Catrin Berseck
Heute habe ich bei mir auf dem Firmengelände in der Mittagspause einen besonderen Fund gemacht, über den ich mich wahnsinnig gefreut habe.
Tränende Saumpilze (Lacrymaria lacrymabunda) sind eigentlich nichts besonderes. Es sind sehr schöne Pilze aus der Gattung der Mürblingsverwandten, die man auch sehr leicht erkennen kann. Der braun bzw. graubraune Hut ist filzig, samtig-faserig und etwas schuppig. Der Stiel ist oft wie der Hut feinsamtig bis schuppig, häufig ist eine stark ausgeprägte Cortina (spinnwebsartiger Schleier) zwischen Stiel und Hut sichtbar. Die fleischbräunliche Scheiden der Lamellen sind bei jungen Exemplaren mit feuchten Tröpfchen „Tränen“ behangen.
Allerdings waren einige meiner gefundenen Pilze besonders, da sie sogenannte Bildungsabweichungen (Teratologie) haben und damit etwas Seltenes sind. Im Handbuch für Pilzfreunde Band V von Michael/Hennig/Kreisel werden diese ausführlich beschrieben.
Die anschließend noch gefundenen Sommersteinpilze waren für mich nur noch Nebensache…
Catrin

Hier der feinschuppige faserige Hut und der spinnwebsartige Schleier (Cortina) zwischen Hut und Stiel.
Foto: Catrin Berseck

Allerdings ist es ungewöhnlich, dass die Tränenden Saumpilze an der Oberseite des Hutes eine kleine Öffnung haben…
Foto: Catrin Berseck

Eine Gruppe Tränender Saumpilze, von denen 3 Exemplare diese Öffnungen auf der Hutoberfläche hatten.
Foto: Catrin Berseck

Sommersteinpilze (Boletus reticulatus) von verschiedenen Standorten. Die größeren Exemplare in der oberen Reihe haben im tiefen Buchenlaub einen extrem großen dicken Stiel ausgebildet. Die 4 kleineren Exemplare wuchsen auf einem moosigen sonnigen Hang und sind dementsprechend kleiner und auch fester.
Foto: Catrin Berseck
21.06.2021 – Sonnabend

Einer von mehreren jungen Sommer-Steinpilzen (Boletus reticulatus) heute im Sophienholz.
Foto: Catrin Berseck
Heute stand eine Öffentliche Wanderung in der Nähe von Neukloster auf dem Plan. Mit 6 Pilzfreunden besuchten wir das Sophienholz zwischen Nevern und Ravensruh – einem Waldgebiet mit vorwiegend Buchen, Fichten aber auch sumpfigen Abschnitten mit Erlenbrüchen.
Unsere Erwartungen hielten sich in Grenzen. Stellenweise war auch nicht ein einziger Pilz zu sehen. Vereinzelt gab es Perlpilze, Täublinge – der erste von den Schnecken zerfressene Sommersteinpilz machte uns jedoch Hoffnung.
Diese Hoffnung wurde letztendlich auch Wirklichkeit – es gab gefüllte Körbe für die Speisepilzsammler.
Den vollständigen Bericht von dieser Öffentlichen Wanderung findet ihr demnächst hier.
Catrin
22.06.2025 – Sonntag

Echte Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) an einem sonnigen Steilhang am See. So ungeschützt haben sie bei der Hitze und der Sonnenstrahlung ausgesetzt keine Chance zu wachsen und vertrockenen bereits im ganz jungen Stadium.
Foto: Sylvina Zander
Nach der Öffentlichen Wanderung gestern sind Dorit, Sylvina und ich noch in die nahegelegene Kleinstadt Brüel gefahren. Ich bin dort ab und zu mal unterwegs und wollte den Beiden noch einige interessante Stellen zeigen.
Zuerst suchten wir einen kleinen See auf, welcher ein interessantes Pilzgebiet ist. Wir machten dort einen schönen Spaziergang im schattigen Uferbereich und konnten dort sogar einige Pilze trotz der Trockenheit entdecken.
Dann ging es zum Abschluss noch auf den Brüeler Friedhof. Friedhöfe sind ja bekanntermaßen interessante Pilzgebiete. Der erste Eindruck beim Betreten war: Das ist hier doch staubtrocken – hier wächst doch nichts. Weit gefehlt! Wir entdeckten Fransige Wulstlinge und massenweise wunderschöne Ziegelrote Risspilze. Für Sylvina und Dorit waren es die ersten Ziegelroten Risspilze, die sie im Habitat gesehen haben. Ich denke mal, dass die Beiden denen in Zukunft öfter mal begegnen werden.
Es war jedenfalls ein schöner Tagesabschluss nach der Öffentlichen Wanderung.
Catrin

Dagegen fühlt sich dieser Flockenstielige Hexen-Röhrling (Neuboletus erythrophus) aber scheinbar an diesem Trockenhang wohl.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir ganz junge Lungen-Seitlinge (Pleurotus pulmonarius) aus der Rinde eines toten Buchenstammes hervorbrechen.
Foto: Sylvina Zander

Neben dem alten Friedhof in Brüel wurde erst kürzlich dieses Hinweisschild aufgestellt, dass auf den Naturerlebnispfad mit „Pilzy Pilz“ und „Biber Ben“ aufmerksam macht.
Foto: Sylvina Zander

Auf dem Friedhof in Brüel wimmelte es nur so von Nymphen der Gemeinen Feuerwanze (Pyrrhocoris apterus) in verschiedenen Altersstadien. Nymphen haben eine überwiegend rote Färbung mit schwarzen Flecken entlang des Rückens. Mit jeder Häutung werden Sie den erwachsenen Tieren immer ähnlicher.
Foto: Sylvina Zander

Massenweise Ziegelrote Risspilze (Inosperma rubescens) fanden wir auf dem Brüeler Friedhof auf den moosigen Rasenflächen.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir deutlich die aufreissende Huthaut mit ihrer radialfaserigen Struktur und der ziegelroten Verfärbung.
Foto: Catrin Berseck
23.06.2025 – Montag
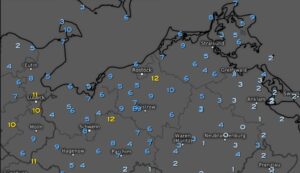
Die Niederschlagsmengen vom 23.06.2025. Im Bereich Lübeck, Baumgarten und Groß Lüsewitz hat es mit über 10 l den meisten Regen gegeben.
Quelle: Kachelmannwetter
Erst mal zum Wetter. Nach dem Hitzewochenende kam es bereits in der Nacht vom Sonntag zu Montag zu teils kräftigen Schauern und Gewittern. Diese wurden örtlich von Starkregen, Hagel und Sturmböen begleitet. Auch heute zeigen sich dichte Wolkenfelder, die für Starkregen und Sturmböen sorgten.
Laut Vorhersage sollen die Temperaturen wieder steigen – bis Donnerstag ist aber stellenweise weiterhin mit Regen zu rechnen.

Grauer Wulstling (Amanita excelsa) mit teilweise durch den Regen abgewaschenen Flocken auf dem Hut.
Foto: Catrin Berseck
Nach Feierabend war ich nur kurz nach dem Regen meinem Buchenwald auf dem Heimweg inspizieren.
Die Hainbuchenraufüße haben die Hitze am Wochenende nicht vertragen und sind eingetrocknet. Vereinzelt kamen noch frische Sommersteinpilze und Täublinge.
Aber der Regen hat die Schnecken wieder aktiviert – es gab kaum einen Frischpilz, der nicht von ihnen belagert und gefressen wurde.
Wie bereits vorher schon berichtet, ist das Pilzwachstum in den Wäldern tatsächlich nur stellenweise gut. Auch auf unserer Öffentlichen Wanderung am Sonnabend haben wir stellenweise kaum Pilze gefunden – an einigen Stellen sah es ganz anders aus…
Die jetzigen Regenfälle und steigenden Temperaturen sollten aber in nächster Zeit ihre Wirkung zeigen.
Catrin

Die Farbvariabilität des Speisetäublings lässt Verwechslungen mit mehreren anderen Täublingsarten zu. Aber an seinem wichtigsten Merkmal ist er durchaus zu erkennen: an seiner zu kurz geratenen Huthaut, die die Lamellen ein Stück weit frei gibt.
Foto: Catrin Berseck

Graugrüner Dachpilz (Pluteus salicinus) an Totholz. Er enthält in geringen Mengen Psilocybin und gehört deswegen in dieser Gattung zu den Giftpilzen.
Foto: Catrin Berseck
24.06.2025 – Dienstag
Heute Abend waren mal wieder Parks und Wiesen Ziel meines Feierabendspaziergangs.
Auch dort tut sich nach dem Regen von Sonntagnacht so einiges. Einige Vertreter der typischen Frühsommerpilze waren bereits am Start.
An den Straßenrändern sieht man jetzt wieder Schirmpilze – auf Wiesen und in Parkanlagen Champignons und auch die Nelken-Schwindlinge blühen nach dem Regen wieder auf…
Hoffen wir mal, dass es mit dem Pilzwachstum so weiter geht.
Catrin

Einer der größten in seiner Gattung – Weißer Anis-Champignon bzw. Schafchampignon (Agaricus arvensis). Die Lamellen sind jung an der Hutunterseite sternförmig (zahnradförmig) vom Hutrand abreißend.
Foto: Catrin Berseck

Nelkenschwindlinge (Marasmius oreades), die die Eigenschaft besitzen, sich bei trockenem Wetter quasi selbst zu Trockenpilzen zu konservieren um bei Regenwetter wieder neu aufzuleben. Sie sind plötzlich wieder zu sehen und man könnte denken, sie seien geradeswegs frisch aus dem Boden gesprossen…
Foto: Catrin Berseck

Die Pfifferlinge (Cantharellus cibarius) lassen sich nach dem Regen nun auch endlich blicken. In einer Parkanlage unter Eiche.
Foto: Catrin Berseck
26.06.2025 – Donnerstag
Heute möchte ich nur mal kurz zeigen, wie sich die kleinen Lungenseitlinge vom Sonnabend innerhalb von 5 Tagen entwickelt haben.
Catrin
27.06.2025 – Freitag
Nach den Regenfällen und Catrins zahlreichen Pilzfunden dachte ich, wir könnten auch einmal in unserem Hauswald nachsehen. Sich nach der Arbeit im Wald zu entspannen, ist schließlich immer eine gute Idee – selbst wenn sich kaum Pilze finden lassen.
Die ersten beiden Täublinge, die wir entdeckten, waren allerdings so stark von Schnecken zerfressen, dass sie sich nur vage als Frauentäublinge identifizieren ließen.
An einem uns bereits seit Längerem bekannten, abgestorbenen, aber noch aufrecht stehenden Baum, der im Winter Austernseitlinge und im Sommer Lungenseitlinge hervorbringt, wurden wir fündig. Die frischen Lungenseitlinge waren noch unversehrt von Schnecken, und so konnten wir ein kleines Büschel ernten. Es war zwar keine große Ausbeute, reichte aber als feine Zutat für eine Suppe.
Zum Rezept für eine Miso-Suppe mit Nudeln und Lungenseitlingen geht es hier.

Ein kleines Büschel Lungenseitlinge (Pleurous pulmonarius) an einer abgestorbenen, aber noch aufrechten Buche.
Foto: Maria Schramm
Neu! Willkommen in unserer Wilden Pilzküche
Ob Steinpilz, Pfifferling, Parasol oder Schwefelporling – wer durch den Wald streift und gern essbare Pilze sammelt, weiß: Der wahre Genuss beginnt erst in der Küche. Erst durch sorgfältiges Zubereiten entfalten sich die Aromen und Texturen, die Pilzgerichte besonders machen.
Auf einer neuen Unterseite des Steinpilz möchten wir ab jetzt unsere Lieblingsrezepte zu Wildpilzen teilen – von einfachen Brotzeitideen über herzhafte Klassiker bis hin zu modernen Kreationen. Alle Gerichte lassen sich mit selbst gesammelten Pilzen nachkochen – und sollen zeigen, wie vielfältig, aromatisch und unkompliziert Pilzküche sein kann.
Die Rezepte stammen von unseren Vereinsmitgliedern, wurden ausprobiert, variiert und mit Begeisterung gegessen. Manche sind traditionelle Rezepte, andere überraschend neu.
Wir laden euch ein, mitzukochen und auszuprobieren – und vielleicht sogar eure eigenen Rezepte mit uns zu teilen, so dass wir nach und nach eine Vielfalt an Zubereitungsideen zusammentragen können!
Ein paar Meter tiefer im Wald begegneten wir ihm wieder – dem Orakelpilz Schwefelporling (Laetiporus sulphureus). An einer umgestürzten Eiche hatte er sich an mehreren Stellen entwickelt. Einige Fruchtkörper waren noch sehr jung und nicht erntereif – dort könnten wir in ein paar Tagen noch einmal nachsehen.

Die anderen Fruchtkörper hatten bereits halbkreisförmige Konsolen mit welligem Rand ausgebildet. Sie wuchsen übereinander und verteilt über den Stamm und leuchteten oben gelb-orange und unten schwefelfarben.
Foto: Maria Schramm
So dünn und zart wie sie waren, konnten wir nicht widerstehen und schnitten wir uns ein paar schnitzelgroße Stücke heraus und nahmen sie mit.
Zum Rezept „Schnitzel-Stulle“ geht es hier.
Maria
28.06.2025 – Sonnabend
Heute musste ich gar nicht weit gehen, um interessante Pilze zu finden… Direkt vor meinem Fenster in einer Rabatte mit Holzhackschnitzeln waren massenweise Tiegelteuerlinge (Crucibulum laeve) – Pilz des Jahres 2014. Sie werden in England aufgrund ihres Aussehens „Vogelnestpilze“ oder im skandinavischen Ländern „Brotkorbpilz“ genannt.
Die deutsche Bezeichnung Teuerling stammt aus dem Mittelalter, als man anhand der Anzahl und der Form der münzenähnlichen Peridiolen glaubte, auf Teuerungszeiten schließen zu können. Die Peridiolen wurden als Geldstücke angesehen – viele Peridiolen im Tiegel der Teuerlinge bedeutete viele Geldstücke – also Teuerung (steigende Preise).
Teuerlinge wachsen bevorzugt nach Regen – also schlechtem Wetter – was zu einer schlechten Getreideernte und steigenden Getreidepreisen und hohen Brotpreisen führte.
Weitergehende Kommentare bezugnehmend auf die heutige Zeit spare ich mir…
Als Peridiole bezeichnet man die rundlichen oder linsenförmigen Körperchen (Sporenbehälter), in denen bei Teuerlingen die Sporen gebildet werden.
Catrin

Junge Tiegelteuerlinge sind gelb- bis rotbraun und geschlossen. Im Alter ändert sich die geschlossene kugelartige Form in eine offene schlüsselartige Form, in denen die Sporenbehälter dann sichtbar werden.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir die weißen linsenförmigen Sporenbehälter (Peridiolen). Diese werden von Vögeln als Samen angesehen und aufgenommen und so von ihnen verbreitet. Wenn Regentropfen in die geöffneten Tiegel fallen, können die Kapseln dadurch herausgeschleudert werden und haften mit einem Klebfaden an Pflanzen der Umgebung an. Sobald diese Kapseln dann zusammen mit der Pflanze von Tieren gefressen werden, gelangen die Sporen in neue Lebensräume und verbreiten sich.
Foto: Catrin Berseck
29.06.2027 – Sonntag
Erst einmal zum Wetter. Zwischen einem Hoch mit Schwerpunkt über den Britischen Inseln und der Nordsee und einem Tief über Nordosteuropa fließt mit westlicher bis nordwestlicher Strömung warme Luft nach Mecklenburg-Vorpommern.
In der Folge erwärmt es sich zunehmend – am Mittwoch sind laut dem Deutschen Wetterdienst Höchsttemperaturen bis zu 35 Grad möglich. Erst in der Nacht zum Donnerstag könnte es in Westmecklenburg Schauer- und Gewitter geben. Bis zum Wochenende ist dann mit weiteren Regenfällen zu rechnen.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Letzte Woche habe ich seltene und auch kuriose Pilze gefunden, die ich euch hier zeigen möchte.
Catrin

Der Sternstäubling hat seinen Namen bekommen, da er im Alter später sternförmig aufreißt. Hier ein Foto vom 28.06.2024.
Foto: Catrin Berseck

Netzflockiger Rosatäubling oder Morgenrot-Täubling (Russula Aurora). Die Huthaut ist „morgenrot“ oder anderen Rot- und Rosatönen – in der Mitte ockergelb und der Rand ist oft heller.
Foto: Catrin Berseck

Weitere Merkmale des „Netzflockigen“ Täublings sind der weiße bereifte und im oberen Drittel netzflockige Stiel. Bei den Lamellen sehen wir am Grund Querlamellen (Anastomosen).
Foto: Catrin Berseck

Da es in Mitteleuropa über 30 rothütige Täublinge gibt und diese auch in der Farbe je Art variieren können, ist die Unterscheidung oft nicht einfach. Der Morgenrot-Täubling lässt sich aber makrochemisch sicher bestimmen – hier sehen wir die typisch rote (für mich pinke) Farbreaktion mit Sulfovanillin.
Foto: Catrin Berseck

Das Besondere an diesem Täubling war allerdings, dass er eine Bildungsabweichung hat und sich aus dem Hut ein weiterer kleiner Fruchtkörper entwickelt.
Foto: Catrin Berseck

Ein im Laubwald häufig zu findender Täubling ist der Purpurschwarze Täubling (Russula atropurpurea) mit seiner schwarzen Hutmitte.
Foto: Catrin Berseck

Allerdings ist es nicht häufig, dass sich aus dem Stiel ein weiterer Hut bildet.
Foto: Catrin Berseck

Hier kann man im Detail erkennen, dass sich unter dem Hut am Stiel Lamellen bilden. Es handelt sich ebenfalls um eine seltene Bildungsabweichung.
Foto: Catrin Berseck
30.06.2025 – Montag

Ein Prachtexemplar eines Sommer-Steinpilzes (Boletus reticulans). Zu erkennen am weißen Stielnetz und dem samtartigen Hut.
Foto: Eiman Khwiled
Eiman und Hanjo sind am Sonntag jeweils in ihren Wäldern unterwegs gewesen und haben mehr oder weniger gefunden. Da beide Gebiete nicht weit voneinander entfernt liegen, haben sie vor ca. 1 Woche ungefähr dieselben Niederschlagsmengen abbekommen.
Eiman war im Revier Weiße Krug unterwegs – ausgedehnte Waldgebiete auf meist sandigen Böden. Dominant sind hier oft Kiefern- und Fichtenforste, aber auch größere Buchenwaldbereiche mit kleineren und größeren Seen.
Hanjo dagegen war im Rühner Forst unterwegs – überwiegend Buchenwälder auf kalkhaltigem lehmigen Boden, die mit Nadelforsten durchsetzt sind und ausgedehnte feuchte bzw. moorige Erlenbrüche enthalten.
Unterschiedlicher könnte die Ausbeute trotzdem nicht sein – auf Eimans sandigen und teilweise sauren Böden war deutlich mehr als auf den lehmigen kalkhaltigen Böden von Hanjo zu finden.
Catrin, Eiman und Hanjo

Ein alter großer Sommersteinpilz mit einem rissigen, von der Trockenheit gezeichneten Hut.
Foto: Eiman Khwiled

Frische Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius) sind derzeit fast überall zu finden. Unter anderem an ihrem anisartigen Geruch zu erkennen,
Foto: Eiman Khwiled

Und auch die ersten Rotbraunen Scheidenstreiflinge (Amanita fulva) sind am Start. Zu erkennen an der lappigen Scheide und der Riefung am Hutrand.
Foto: Eiman Khwiled

Spindelige Rüblinge (Gymnopus fusipes). Er löst an den Wurzeln von lebenden Bäumen Weißfäule aus und gilt deshalb als gefürchteter Baumparasit.
Foto: Hanjo Herbort

Der hochgiftige Zimtfarbene Weichporling (Hapalopilus rutilans) enthält Polyporsäure. Diese führt zu zentralnervösen Störungen, Sehstörungen und Erbrechen. Ein markantes Symptom nach dem Verzehr ist das Ausscheiden von violett verfärbtem Urin. Er ist ein beliebter „Färbepilz“, der eine schöne violette Farbe ergibt.
Foto: Hanjo Herbort

Ein weiterer beliebter „Färbepilz“ sind junge Nadelholzbraunporlinge (Phaeolus spadiceus). Beim Färben von Wolle und Naturfasern ergibt er in diesem Stadium die schönsten goldgelben Farbtöne.
Foto: Catrin Berseck
31.05.2025 Öffentliche Wanderung im Warnowtal bei Gädebehn
Öffentliche Pilzlehrwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
Durch das Warnowtal bei Gädebehn
Zum Abschluss des Mai besuchten wir mal wieder im Rahmen einer Öffentlichen Lehrwanderung dieses reizvolle Gebiet unweit der mecklenburgischen Kleinstadt Crivitz. Ein nicht nur für Pilzfreunde attraktives Wanderziel.
Die Warnow mäandert hier durch Wälder und Wiesen und hat bei Kladow/Gädebehn ein Tal mit bewaldeten Hängen geschaffen. An den Steilhängen finden wir einen lichten Baumbestand aus hauptsächlich Buchen – aber auch eingestreuten Eichen und Kiefern.
Um 9 Uhr trafen sich 8 Pilzinteressierte in Kladow bei Gädebehn zu einer Wanderung entlang der Warnow und zurück durch eine alte Eichenallee am Rande eines Feldes.
Unsere Erwartungen bezüglich Frischpilzen hielten sich aufgrund des zu lange ausgebliebenen Regens in Grenzen – wir wurden jedoch positiv überrascht.
Wir wollen euch mit diesem Beitrag einen kleinen Einblick von dieser sehr schönen Wanderung geben. Auch wenn es mal nicht so viele Pilze gibt – es gibt immer genug Spannendes und Interessantes auf unseren Wanderungen zu entdecken.
Falls ihr auch gerne mal dabei sein wollt – hier die nächsten Termine. Diese werden demnächst noch ergänzt.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Wir trafen uns zu unserer heutigen Wanderung auf dem Parkplatz vor dem Friedhof in Kladow bei Gädebehn. 1317 wurde die kleine Kladower Dorfkirche erstmals urkundlich erwähnt. Der mittelalterliche Backsteinbau wurde 1780 spätbarock umgebaut.
Foto: Angeli Jänichen

Mittlerweile sind alle Teilnehmer pünktlich eingetroffen – wie immer auch aus dem benachbarten Schleswig-Holstein.
Foto: Angeli Jänichen

Trotz vieler prüfender Blicke blieben diese Holzbewohner gleich zu Beginn unbestimmt.
Foto: Angeli Jänichen

Judasohren (Auricularia auricula-judae) an Holunder – dem bevorzugten Substrat. Im Gegensatz zu vielen anderen Pilzfruchtkörpern ist das Judasohr das ganze Jahr hindurch zu sehen.
Foto: Dirk Fuhrmann

Hier sehen wir sehr schön die feinfilzige Oberfläche und die feinen Adern des Judasohres.
Foto: Christian Boss

Eine normale eigentlich langweilige Striegelige Tramete (Trametes hirsuta) von oben.
Foto: Angeli Jänichen

Sie hatte sich auch einen Gemeinen Spaltblättling (Schizophyllum commune) einverleibt, der wiederum von einem der Pilzkäfer – dem Rotfleckigen Faulholzkäfer (Tritoma bipustulata) bewohnt wurde.
Foto: Christian Boss

Auch der Gelbbindige Schwarzkäfer (Diaperis boleti) lebt in und an den Fruchtkörpern verschiedener Baumpilzarten – hier am Rotrandigen Baumschwamm (Fomitopsis pinicola).
Foto: Angeli Jänichen

Hier noch einmal eine Gruppe wunderschöner junger Rotrandiger Baumschwämme (Fomitopsis pinicola) an Buche.
Foto: Angeli Jänichen

Und Theo – unser jüngster Teilnehmer – fand auch den ersten Frischpilz mit Hut und Stiel. Es ist der Wurzelnde Schleimrübling (Hymenopellis radicata).
Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir die namensgebende Wurzel. Der Wurzelnde Schleimrübling wächst als Parasit und Saprophyt auf morschem, totem Laubholz, bevorzugt dem von Rotbuchen, oft scheinbar auf dem Erdboden, wobei der wurzelnde Stiel mit den Baumwurzeln der Wirtsbäume verbunden ist.
Foto: Angeli Jänichen

Hier noch ein Exemplar der Wurzelnden Schleimrüblings. Man kann sehr gut den radialrunzelig gerieften und schmierigen Hut erkennen.
Foto: Angeli Jänichen

Am Wegrand im Gras fanden wir dann einen grazilen nicht näher bestimmten Scheibchentintling aus der Gattung Parasola.
Foto: Angeli Jänichen

Viel Totholz an und der der Warnow bei Gädebehn, wofür auch teilweise der Biber verantwortlich ist.
Foto: Christian Boss

Hier hat der Biber sich mal als Bildhauer betätigt und eine Skulptur erschaffen. Die Deutung dieses Kunstwerkes überlassen wir der Phantasie des Betrachters.
Foto: Christian Boss

Diesen Goldglänzenden Rosenkäfer (Cetonia aurata) hat Christian in einem Ameisenhaufen entdeckt. Kein Wunder, denn die Weibchen der Rosenkäfer lassen ihre Eier über einem Ameisenhügel fallen. Diese werden von den Ameisen in das Hügelinnere getragen. In dem modernden Holz des Baumstumpfes, der die Grundlage für den Ameisenhügel gebildet hat, entwickeln sie sich zu Larven. Sie wachsen in dem Bau in mehreren Jahren zu stattlichen Engerlingen heran, ohne von den Ameisen getötet zu werden, verpuppen sich dann im Ameisenbau, um ihn danach als fertiger Käfer zu verlassen.
Foto: Christian Boss

Am Wegrand zeigte sich dann auch ein einzelner Täubling. Hier der Papageientäubling (Russula ionochlora).
Foto: Christian Boss

Es handelt sich Schwarzschneidige Helmlinge (Mycena pelianthina), die vorrangig in der Laubstreu der Buchenwälder anzutreffen sind.
Foto: Angeli Jänichen

Die schmutzig lila Lamellen sind breit bauchig und mit Zahn angewachsen. Schon mit bloßem Auge, aber viel besser mit der Lupe, sind die schwarzgezähnelten Lamellenschneiden zu erkennen, die dem Pilz seinen Namen gegeben haben.
Foto: Christian Boss

Hier sehen wir gleich zwei Vertreter der Schleimpilze – den Orangenen Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum) und ein junges weißes Fadenkeulchen aus der Gattung Stemonitis.
Foto: Angeli Jänichen

Auch für Ascomyceten hatten wir ein Auge. Ein Rostpilz (Puccinia sesselis var. sessilis) an Vielblütiger Weißwurz (Polygonatum multiflorum).
Foto: Catrin Berseck

Es geht aber noch kleiner. Hier unter 1 mm kleine Bräunliche Buchenblatt-Haarbecherchen (Brunnipila fuscescens) auf Buchenblättern.
Foto: Catrin Berseck

Da der Pilz mit bloßem Auge schon kaum zu erkennen ist – hier mal ein Blick auf die Haare des Bräunlichen Buchenblatt-Haarbecherchens durch das Mikroskop. Die Härchen haben eine raue ornamentierte Oberfläche und sind mehrfach septiert. Am Ende der Haare sehen wir Kristallauflagerungen.
Foto: Catrin Berseck

Noch ein Blick auf die Warnow – mittlerweile wurde das andere Waldufer von Wiesen abgelöst.
Foto: Angeli Jänichen

Und dann trauten wir unseren Augen kaum. Im Laubstreu die ersten Schopftintinge (Coprinus comatus) des Jahres und Pilz des Jahres 2024. Hier noch ein junges Exemplar mit einem ei- bis walzenförmigen Hut.
Foto: Angeli Jänichen

Im zunehmendem Alter öffnet er sich und wird allmählich glockenförmig – Hut und Lamellen lösen sich in einer tintenartigen Flüssigkeit auf. Dieser Prozess ist eine Autolyse. Diese Eigenart ist eine Methode, Sporen zu verbreiten. Diese tropfen mit der Flüssigkeit ab, werden parallel aber auch als Staub durch Luftbewegungen verbreitet.
Foto: Angeli Jänichen

Und dann fanden wir tatsächlich noch diese beiden jungen Riesenschirmpilze (Macrolepiota procera) am Steilhang im Buchenlaub. Der genatterte Stiel ist bereits zu erkennen. So jung eigentlich noch nicht zu bestimmen – aber wir haben ihn ihn aufschirmen lassen.
Foto: Angeli Jänichen

Hier sieht man gut, wie die Natterung des Stiels und die Schüppchen auf der Huthaut entstehen. Beim Wachsen reißen die obersten dunklen Hautschichten auf, die dann als dunklere Reste an der Stieloberfläche (Natterung) und als dunkle Schüppchen auf der Huthaut verbleiben. Die lamellenschützende Teilhülle (Velum partiale) reißt zuerst am Stiel ab – beim Aufschirmen dann noch am Hutrand. Dadurch entsteht der „doppelte Ring“.
Foto: Angeli Jänichen

Und immer, wenn Sylvina mit dabei ist, bekommen wir so wunderschöne Aquarelle von einigen auf der Wanderung gefundenen Pilze.
Foto: Sylvina Zander

Ausnahmsweise den Blick mal nicht auf den Boden, sondern in den Himmel gerichtet.
Foto: Christian Boss
Die Artenliste aus dem Warnowtal bei Gädebehn im MTB 2335/43 – Langen Brütz
Buchenrindenschorf (Ascodichaena rugosa), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Münzenförmige Kohlenbeere (Biscogniauxia nummularia), Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta), Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen (Brunnipila fuscencens), Schopf-Tintling (Coprinus comatus), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Ästiger Stachelbart – alte FK (Hericium coralloides), Rotbraune Borstenscheibe (Hymenochaete rubiginosa), Schleimiger Wurzelrübling (Hymenopellis radicata), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxlon fragiforme), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxylon fuscum), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Blutmilchpilz (Lycogala edidendrum), Parasol (Macrolepiota procera), Schwarzschneidiger Helming (Mycena pelianthina), Brombeerrost (Phragnidium violceum), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Weißwurz-Rost (Puccinia sessilis var. sessilis), Papageien-Täubling (Russula ionochlora), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Birken-Blättling (Trametes betulina), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Striegelige Tramete (Trametes hirsuta), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
21.05.2025 – MTB 2234/4 am Neddersee bei Gadebusch
Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch
21. Mai 2025
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2232/4 – Nördlich GDB

Blick auf die Radegast, die hier im nordwestlichen Teil in den Neddersee eintritt.
Foto: Angeli Jänichen
Zum letzten Mal in diesem Jahr führte uns unsere Mittwochsexkursion in das Messtischblatt Gadebusch. Genauer gesagt in den vierten Quadranten.
Wir entschieden uns aufgrund des weiterhin fehlenden Regens wieder für ein Feuchtgebiet – den Neddersee. Der Neddersee liegt nördlich von Gadebusch und damit nördlich des Quellgebietes der Radegast, genauer gesagt im Süden des Landschaftsschutzgebiets Radegasttal. Am Nordwestufer – unserem Kartierungsgebiet – tritt die Radegast in das Gewässer ein und verlässt dieses nach dem Durchfluss am Südufer wieder. Der See verfügt zudem über weitere kleine Zuflüsse bzw. Abflüsse.
6 Mitglieder der Gruppe der Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. trafen sich um 16 Uhr vor Ort.
Da das Ufer des Sees von dichtem Baum- und Strauchwerk und moorigem Untergrund umsäumt ist, begingen wir nur einen kleineren Bereich am Neddersee und der Radegast und besuchten anschließend noch den Gadebuscher Stadtwald, der sich ebenfalls in unserem Kartierungsgebiet befindet.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Direkt im Uferbereich fanden wir fast alle Morchelanzeigerpflanzen – auch den Aronstab. Hier sehen wir den Aronstabrost (Puccinia sessilis var. arum) an der Blattunterseite.
Rostpilze gehören – wie man aufgrund der Größe vermuten könnte – nicht zu den Schlauchpilzen (Ascomyceten), sondern zu den Ständerpilzen (Basidiomycoten).
Foto: Catrin Berseck

Weiter ging es nördlich des Sees über die Bahnschienen in einen Buchenbereich, wo wir auch diese beiden zusammengewachsenen Buchen fanden.
Foto: Christian Boss

Dieser junge Rotrandige Baumschwamm (Fomitopsis pinicola) wuchs an einer Birke. Der Rand ist zur Wachstumszeit weißlich, erst im Alter bekommt er den namensgebenden rot bis rotbraunen Rand.
Foto: Angeli Jänichen

Ebenfalls an Birke viele vorjährige Fruchtkörper des Birkenporlings (Fomitopsis betulina).
Foto: Angeli Jänichen

Ältere Rötliche Kohlenbeeren (Hypoxylon fragiforme) auf Buche.
Ähnlich ist die Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxylon fuscum), die jedoch nur auf toten Zweigen von Hasel oder Erle wächst.
Foto: Angeli Jänichen

Phillip kontrolliert erst mal seine Ausbeute an Ascomyceten und kleinen Vertretern der Basidiomyceten. Die werden zu Hause dann noch fast alle von ihm mikroskopiert, um ihnen einen Namen geben zu können.
Foto: Angeli Jänichen

Orangeroter Helmling (Mycena acicula). Acicula bedeutet kleine Nadel – was schon etwas zu seiner Größe sagt. Man findet ihn an abgestorbenen Pflanzenresten, vorrottendem Holz, gern in moosiger oder grasiger Umgebung. Seine durchscheinend gerieften Hüte erreichen gerade mal 0,5 bis höchstens 1 cm Durchmesser. Sie sind von halbkegeliger bis etwas glockiger Gestalt und lebhaft gelborange bis orangerot gefärbt, wobei die Hutmitte gerne etwas dunkler ist. Die dünnen, oft etwas transparenten aber auch fein bereiften Stiele können dagegen bis zu 7 cm lang werden.
Foto: Christian Boss

Hier ebenfalls ein Vertreter der Helmlinge, der leider nicht bestimmt werden konnte.
Foto: Christian Boss

Da wir uns für fast alles in der Natur interessieren – hier ein schönes Foto vom Schachtelhalm.
Foto: Angeli Jänichen

Unser obligatorisches Gruppenfoto unter dem Bogen einer Weide am Neddersee.
Da wir dort aufgrund des Buschwerkes nicht mehr weiter kamen, beschlossen wir noch in den Gadebuscher Stadtwald – der ebenfalls im 4. Quadranten liegt – zu fahren.
Foto: Angeli Jänichen
Die Artenliste vom nordwestlichen Ufer des Neddersees im MTB 2232/431
Birnenstäubling – alte FK (Apioperdon pyriforme), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), keine deutscher Trivialname (Dennisiodiscus sparganii), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alte FK (Fomitopsis betulina), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Wulstiger Lackporling (Ganoderma adspersum), Rötliche Kohlenbeere (Hypoxlon fragiforme), Kurzhaariges Weißhaarbecherchen (Lachnum brevipilosum), „Sumpseggen-Weichbecherchen“ (Mollisia asteroma), Bogenblättriger Helmling (Mycena speirea), Orangeroter Helmling (Mycena acicula), Weidenfeuerschwamm (Phellinus igniarius), Polsterförmiger Feuerschwamm (Phellinus punctatus), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Aronstab-Rost (Puccinia sessilis, var. arum), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Erlenschillerporling (Xanthoporia radiata)

Weg in den Gadebuscher Stadtwald. Er befindet sich auf lehmigem Untergrund und besteht überwiegend aus Buchenbeständen, die 60 bis 100 Jahre alt sind. Sie sind in den vergangenen Jahrzehnten schonend bewirtschaftet worden und weitestgehend geschlossen. Es gibt zerstreut zu findenden Quellbereiche, sommertrockene Fließgewässer und Waldtümpel.
Foto: Angeli Jänichen

Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa). Ein parasitärer Pilz, zumeist auf dem unteren Stammteil, der schwarze Streifen auf der Rinde verursacht, insbesondere bei Rotbuchen. Die Pyknosporen werden vor allem bei feuchtem Wetter entlassen und von Schnecken auf der Baumrinde verteilt, wodurch diese damit maßgeblich zur Verbreitung des Pilzes beitragen.
Foto: Angeli Jänichen

Kaum war der erste Tümpel zu sehen, ist Phillip zwischen den Sumpf-Schwertlilien (Iris pseudacorus) auf Pilzsuche abgetaucht.
Foto: Angeli Jänichen

Bewimperter Schildborstling (Scutellinia crinita). Crinita bedeutet behaart bzw. langhaarig. Die Gattung der Schildborstlinge gehört mit etwa 30 mitteleuropäischen Arten zu den Schlauchpilzen (Ascomyzeten). Um sie sicher zu unterscheiden, müssen ökologische und vor allem mikroskopische Merkmale beachtet werden.
Foto: Angeli Jänichen

Und hier hat Christian auf nassem Kraut einen Schleimpilz (Myxomycet) gefunden.
Schleimpilze sind einzellige Lebewesen, die nicht zu den Pilzen gehören, sondern eher eine Art von Amöben sind. Sie haben eine Schleimstruktur (Plasmodium) und können Winzlinge, die sich mit Sporen fortpflanzen, bilden. Obwohl sie „Pilze“ genannt werden, haben sie Eigenschaften von Tieren und Pilzen gleichermaßen, sind aber keiner dieser Gruppen zugeordnet.
Foto: Christian Boss
Die Artenliste vom Stadtwald Gadebusch im MTB 2232/443
Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Mai-Stielporling (Polyporus ciliatus), Dickblättriger Schwärztäubling – alter FK (Russula nigricans), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Bewimperter Schildborstling (Scutellinia crinita)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
07.05.2025 – MTB 2232/3 im Breesener Torfmoor
Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch
Auch für Pilz- und Naturinteressierte Gäste
Im MTB 2232/3 = Breesener Torfmoor

Blick in das Breesener Torfmoor mit hauptsächlich Birken, Grauweiden und Erlen bewachsen.
Foto: Catrin Berseck
Unsere heutige Mittwochs- bzw. Kartierungsexkursion im 3. Quadranten des Messtischblattes Gadebusch führte uns in das Breesener Torfmoor. Aufgrund der fehlenden Niederschläge mit einem nicht ganz so hohen Wasserstand, so dass es mit Gummistiefeln in Teilbereichen gut begehbar war.
Moore sind zu jeder Zeit interessante Gebiete mit einer Vielfalt an spezialisierten Pflanzen, Tieren und auch Pilzen, die sich den besonderen Gegebenheiten der Landschaft angepasst haben – darunter viele seltene Arten.
Torsten Richter, Christopher Engelhardt und Phillip Buchfink kennen das Moor wie ihre Westentasche und haben hier bereits desöfteren extrem seltene Pilzfunde machen können.
Moore sind faszinierende Lebensräume, die große Mengen an Kohlenstoff in Form unvollständig zersetzter Pflanzenteile speichern können. Sie entstehen, wenn der Boden dauerhaft mit Wasser gesättigt ist und sich Torf bildet. Voraussetzungen für dessen Entstehung sind Sumpfpflanzen. Sterben Pflanzen ab, werden sie durch Mikroorganismen zersetzt. An feuchten Standorten aber geraten die abgestorbenen Pflanzen irgendwann unter die Wasseroberfläche. Dort angekommen, ist die Sauerstoffzufuhr unterbrochen, Mikroorganismen können hier nicht mehr leben, können die Pflanzen nicht weiter zersetzen. Die noch vorhandenen Reste der Pflanze bleiben liegen, bilden Torf.
Moore regulieren den Wasserhaushalt und tragen zur Grundwasserneubildung bei. Intakte Moore speichern riesige Mengen an Kohlenstoff , was sie zu einem wichtigen Akteur im Klimaschutz macht. Das ist ein Grund dafür, immer mehr Moore zu renaturieren.
Text, Fotoauswahl und Beschriftung: Catrin

Eine der seltenen Pflanzen der Moore ist Wasserfeder oder Wasserprimel (Hottonia palustris) – eine unter Wasser wurzelnde Wasserpflanze. Die stark zerteilten Blätter dienen zur Oberflächenvergrößerung und damit zur besseren Aufnahme von Nährsalzen sowie von Sauerstoff und Kohlendioxid.
Foto: Catrin Berseck

Die Wasserfeder ist in der Lage, das temporäre Austrocknen eines Gewässers zu überstehen. Sie bildet dann einen dichten Rasen über dem feuchten Schlammboden, wobei die Blätter wesentlich kleiner bleiben als bei der aquatilen Form.
Foto: Catrin Berseck

Blüten der Wasserfeder. Die Wasserfeder ist nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz und der Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und darf nicht aus der Natur entnommen werden.
Foto: Catrin Berseck

Torsten und Phillip in Ihrem Element. Jeder cm² des Bodens und alle Pflanzen werden akribisch nach Kleinstpilzen abgesucht und zum späteren Bestimmen eingesammelt.
Foto: Catrin Berseck

Beringter Trompetenschnitzling bzw. Moorbirken-Schnitzling (Tubaria confragosa). In der Roten Liste wird er als ‚Gefährdung unbekannten Ausmaßes‘ geführt. Dass es so wenige Fundmeldungen von dieser Art gibt, kann allerdings auch daran liegen, das sie meistens als „unbestimmbar“ im Wald bzw. Moor gelassen werden.
Foto: Catrin Berseck

Bewimperter Schildborstling (Scutellonia crinita) auf Schlamm im Birken-Weidenmoorgebüsch.
Eine Reihe langer Haare ist nach oben gerichtet, ein Kranz aus kürzeren Haaren nach unten.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Feinwarziger Zystidenrindenpilz (Scopuloides rimosa) auf morschem Weidenast.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Auf dem Weg dorthin sahen wir das Kleine Wiesenvögelchen (Coenonympha pamphilus). dieser Schmetterling aus der Gruppe der Tagfalter wird auch Kleiner Heufalter genannt.
Foto: Maria Schramm

Auch der Scharlachrote Feuerkäfer (Pyrochroa coccinea) war wieder vertreten. Wer nachzählen möchte – die Fühler der Feuerkäfer haben elf Glieder und sind bei den Männchen ab dem dritten Glied gekämmt, bei den Weibchen komplett gesägt. Hier sehen wir also ein Weibchen.
Foto: Maria Schramm

Wiesen-Schaumkraut) Cardamine pratensis) ist eine vielseitige Wildstaude, die in Feuchtwiesen wächst. Um auch auf sumpfigen Böden wachsen zu können, weist das Wiesen-Schaumkraut eine Besonderheit auf: Als Gegenmaßnahme gegen die Sauerstoffarmut des Bodens enthalten die Wurzeln Kammern mit Luft.
Foto: Maria Schramm

Am Stamm einer Birke dieser Schiefe Schillerporling (Inonotus obliquus). Er besitzt eine harte, fast schwarze rissige Oberfläche und ist innen zimtbraun mit weißen Flecken gefärbt.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir nicht näher bestimmte Vertreter der Ackerlinge (Agrocybe sp.). Schön zu sehen – die in Fetzen am Hutrand hängenden Velumreste.
Foto: Maria Schramm

Heute im Breesener Moor v.l.n.r.: Maria, Phillip, Torsten und Catrin – Dorit fehlt auf dem Foto.
Foto: Torsten Richter
Die Artenliste aus dem Breesener Torfmoor MTB 2232/331
Orangeroter Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Filzmatten-Kugelpilz (Chaetosphaerella phaestroma) ,Rasiges Hängebecherchen (Cyphellopsis anomala), Blasiges Eckenscheibchen (Diatrype bullata), Leuchtender Rosarindenpilz (Erythricium laetum), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Birkenporling – alte FK (Fomitopsis betulina), Schiefer Schillerporling (Ionotus obliquus), Vielgestaltige Kohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Brombeerrost (Phragmidium violaceum), Feinwarziger Zystidenrindenpilz (Scopuloides rimosa), Bewimperter Schildborstling (Scutellinia crinita), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Goldgelber Zitterling (Tremella mesenterica), Beringter Trompetenschnitzling bzw. Moorbirken-Schnitzling (Tubaria confragosa), Gemeiner Trompetenschnitzling (Tubaria furfuracea)
Pilze/Wetter Mai 2025
Pilze und Wetter Mai 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im Mai 2025
01.05.2025 – Donnerstag
Zuerst zum Wetter des vergangenen Monats für Mecklenburg-Vorpommern.
Der zweite meteorologische Frühlingsmonat 2025 war im Nordosten außergewöhnlich warm. Er gehört zu den fünftwärmsten Aprilmonaten seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. Am 17. wurde in Ueckermünde mit 27,9 °C nicht nur ein selten früher Sommertag, sondern auch ein Extremwert für die bis dahin vorangeschrittene Jahreszeit verzeichnet. Extrem war auch die Niederschlagsbilanz: Mit rund 10 l/m² wurden nur etwa 24 % des Solls von 42 l/m² erreicht. In den küstennahen Gebieten blieb es mit teils weniger als 5 l/m² noch trockener. In der 144-jährigen Messreihe gab es in Mecklenburg-Vorpommern nur vier Aprilmonate, die noch trockener waren. Der Nordosten war folglich die niederschlagsärmste Region im letzten Monat. Die Sonne erreichte rund 260 Stunden, womit das Klimamittel von 167 Stunden um etwa 55 % übertroffen wird.
(Quelle: Deutscher Wetterdienst).

Feldmaikäfer (Melolontha melolontha).
Die Hinterleibsspitze (Pygidium) ist lanzettartig verlängert, wenig beborstet und am Ende nicht verdickt.
Foto: Catrin Berseck
Aufgrund der seit über 3 Monaten anhaltenden Trockenheit ist das Pilzwachstum natürlich mächtig auf der Strecke geblieben.
Also widmen wir uns erst mal nicht den Maipilzen, sondern den Maikäfern!
Viele Menschen sind traurig, dass sie kaum noch Maikäfer sehen. Früher waren Maikäfer sehr häufig und jedem Kind bekannt, wozu sicher auch der 5. Streich aus Wilhelm Busch’s „Max und Moritz“ beitrug.
Bei mir zu Hause erscheinen sie jedes Jahr in Massen. Deswegen möchte ich auch ein paar Fotos teilen und etwas dazu schreiben.
Die Käfer schlüpfen von Ende April bis Mai aus ihrer Puppe im Erdboden und fliegen hauptsächlich im Mai (und Juni). Aus diesem zeitlichen Auftreten leitet sich der Name Maikäfer ab. Das Schwärmen der Maikäfer beginnt in der Dämmerung und dauert bis zur Dunkelheit. Die Käfer ernähren sich überwiegend von den Blättern von Laubbäumen.

Hier sehen wir ein männliches Exemplar der Maikäfer. Erkennbar an den 7 und viel größeren Lamellen der fächerartigen Fühlerspitzen.
Foto: Catrin Berseck
Männchen und Weibchen der Maikäfer unterscheiden sich also in der Anzahl der Fühlerplättchen, die bei den Männchen durch die 7 Fühler etwa 50.000 Geruchsnerven haben; bei den Weibchen hingegen weist die viel kleinere 6-lappige Fühlerfächer ungefähr 9.000 dieser Nerven auf.
Das Männchen stirbt nach der Begattung – die Weibchen sterben erst 4 bis 7 Wochen nach der Eiablage, wobei bei günstigen Bedingungen zwei bis drei Gelege pro Weibchen möglich sind. Bei der Eiablage werden 10 bis 100 Eier abgelegt.
Die Larven entwickeln sich über einen Zeitraum von ca. 4 Jahren. Die Junglarven ernähren sich von zarten Wurzelfasern und Humusstoffen, ältere Larven fressen jede Art von Wurzel. Der Wurzelfraß der Larven bewirkt ein Welken von Blättern, Nadeln und Trieben – die Pflanzen sterben dadurch ab.
Maikäfer – so schön sie auch aussehen – gelten als Schädlinge. Während die Käfer bei Massenaufkommen ganze Laubwälder kahlfressen, wovon sich die Bäume jedoch erholen, sterben durch den Larvenfraß nachwachsende Laubbäume teilweise flächendeckend ab. Seit Anfang der 50-er Jahre wurden deswegen auch mittlerweile verbotene Insektizide zur Bekämpfung der Maikäfer eingesetzt.
Catrin
03.05.2025 – Sonnabend
Heute stand eine geführte öffentliche Wanderung auf dem Programm. Um 9 Uhr trafen sich 11 Pilzinteressierte gut gelaunt bei schönem Frühlingswetter am Prosekener Grund bei Zierow.
Die Erwartungen waren aufgrund des seit nunmehr 3 Monate lang fehlenden Regens nicht so hoch – trotzdem blieb ein wenig Hoffnung, ein paar Speisemorcheln oder Morchelbecherlinge zu finden. Diese Hoffnung erfüllte sich leider nicht…
Trotzdem fuhr Niemand mit leerem Korb nach Hause. Im Prosekener Grund fanden wir massenweise Schuppige Porlinge (Polyporus squamosus) in allen Altersstadien. Einige jüngere Exemplare wanderten in die Körbe der Teilnehmer.
Den genauen Bericht inkl. Fundliste findet ihr hier.
Catrin
05.05.2025 – Montag
Während unseres Seminars in Gallentin fanden wir am 1. Tag diesen kleinen Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) an einer Weide.
Es handelt sich um einen Pilz, der Laubhölzer befällt und dort Braunfäule auslöst. Der Schwefelporling ist jung essbar und wird aufgrund seiner Konsistenz ähnlich Hühnchenfleisch auch „Huhn des Waldes“ bzw. „Chicken of the wood“ genannt.
Natürlich ist dieser kleine Pilz damals an Ort und Stelle verblieben, da er noch viel zu jung war. Gestern erreichte mich die Nachricht von Vera und Wilfried, dass sie ihn am Wochenende – also 1 Woche später geerntet haben. Er war jetzt genau in dem richtigen Alter und brachte sage und schreibe 3,2 kg auf die Waage!
Den Beiden hat der Schwefelporling sehr gut geschmeckt.
Weil ich es nicht besser schreiben könnte, möchte ich hier mit ausdrücklicher Genehmigung Auszüge aus einen interessanten Beitrag über Schwefelporlinge von Andreas Herbrecht von der Pilzberatung Erding/Ebersberg teilen.
Der Schwefelporling ist ein leicht kenntlicher Pilz mit einem eher dezenten Eigengeschmack, dessen kulinarischer Wert eher auf seiner besonderen Konsistenz liegt, die – richtiger Erntezeitpunkt vorausgesetzt – der von Geflügelfleisch recht nahe kommt, weswegen er im Englischen auch „Chicken of the Woods“ heißt.
Ganz jung sind Schwefelporlinge einfach nur wässrig, weich, völlig ohne Textur und kulinarisch entsprechend enttäuschend. Im Lauf der Fruchtkörperreife verändert sich seine Konsistenz, er wird fester und hat erst dann die oben beschriebene Beschaffenheit. Das dauert vom ersten Erscheinen an ca. eine Woche. Zu lange darf man aber auch nicht warten, da die Fruchtkörper dann schnell fest, trocken und zäh werden. In diesem Zustand sind sie nicht mehr verwertbar. Optimal ist der Schwefelporling, wenn er sich nicht mehr weich anfühlt, sich aber noch leicht und ohne zu quietschen schneiden lässt. Derselbe Fruchtkörper ist dann außerdem mindestens dreimal so groß, und es haben entsprechend mehr Menschen Freude dran.
- Zu junger Fruchtkörper. Foto: Andreas Herbrecht
- Fruchtkörper im optimalen Zustand. Foto: Andreas Herbrecht
Die Bilder zeigen einen noch zu jungen Fruchtkörper und denselben Fruchtköper vier Tage später in optimalem Zustand.
Es kursieren auch immer wieder Gerüchte, die behaupten, der Pilz würde die Giftstoffe giftiger Substrate, wie Eibe, Robinie oder Goldregen, oder Gerbstoffe der Eiche aufnehmen und sollte deshalb nicht von solchen Substraten gesammelt werden.
Das ist eine der typischen Schwammerl-Legenden, von denen keiner genau weiß, wo sie herkommen. Sicherlich aber nicht von entsprechenden Vergiftungsfällen, denn solche gibt es nicht.
Pilze verdauen ihre Nahrung außerhalb ihres Organismus durch Ausscheidung von Enzymen, die das Substrat chemisch zerlegen und so erst für den Pilz verfügbar machen. Große Moleküle, wie z.B. organische Giftstoffe, können die Zellwände von Pilzen rein physikalisch schon gar nicht passieren, weshalb die behauptete Aufnahme von Giftstoffen durch den Pilz schon rein physikalisch unmöglich ist. Entsprechende Untersuchungen haben gezeigt, dass Fruchtkörper von auf giftigem Substrat gewachsenen Pilzen keinerlei Giftstoffe des Wirtes enthalten. Dies gilt für alle Pilze. Ein schönes Beispiel hierfür ist der Parasitische Röhrling Pseudoboletus parasiticus, der auf giftigen Kartoffelbovisten parasitiert, selbst aber als essbar gilt.
Catrin
06.05.2025 – Dienstag
Heute hat Sylvina in Lübeck die ersten Schildrötlinge (Entoloma clypeatum) gefunden.
Der Pilz zählt zur Gruppe der „Frühlingsrötlinge“. Dieser Blätterpilz lebt mit Bäumen und Sträuchern aus der Familie der Rosengewächse zusammen, darunter beispielsweise Schlehe, Weißdorn, Kirsche und dem Zierstrauch Felsenbirne. Die Pilzfäden dringen jedoch anders als bei anderen Ektomykorrhizapilzen in die Zellen der Feinwurzeln ein und zerstören diese weitgehend.
Der Schildrötling gilt als Speisepilz – sollte aufgrund der Verwechslungsgefahr mit anderen stark giftigen Rötlingen aber nur von absoluten Kennern gesammelt werden. Es scheiden sich bezüglich der Essbarkeit auch die Geister – manche Autoren halten die Fruchtkörper für essbar, andere dagegen als giftverdächtig; eine Schmackhaftigkeit wird oft verneint. Aus der Türkei wurden Vergiftungsfälle bekannt.
Neben anderen giftigen Rötlingen ist dieser Rötling dem Schlehenrötling (Entoloma sepium) sehr ähnlich. Ein wichtiges makroskopisches Unterscheidungsmerkmal ist, dass sich die Madenfraßgänge beim Schlehenrötling orangebraun verfärben – beim Schildrötling zeigt sich keinerlei Verfärbung.
Trotzdem bitte immer Vorsicht beim Sammeln von Rötlingen für Speisezwecke! Es gibt fast nur giftige Pilze in dieser Gattung.
Catrin

Hier die Schildrötlinge (Entoloma clypeatum) am Originalstandort unter einer Felsenbirne.
Foto: Sylvina Zander
07.05.2025 – Mittwoch
Es ist Mittwoch und die nächste Mittwochsexkursion stand an. Zwei Quadranten des Messtischblattes Gadebusch sind bereits abgearbeitet.
Wir entschieden uns vorher, das Breesener Torfmoor aufzusuchen. Aufgrund der bereits zu lange anhaltenden Trockenheit rechneten wir mit einem nicht so hohen Wasserstand – also ging es mit Gummistiefeln in das Moor.
Moore sind zu jeder Zeit interessante Gebiete für Pilzkartierungen. Laut Phillip und Torsten ist das Breesener Torfmoor „ein besonderes Sahnestück“ dieses Quadranten.
Und die Beiden hatten Recht – wir sollten nicht enttäuscht werden. Auch wenn es bei dieser Exkursion hauptsächlich um Ascomyceten ging, hatten wir einen wunderschönen Nachmittag in dieser einmaligen Gegend bei schönstem Wetter.
Einen vorläufigen Bericht inkl. vorläufiger Fundliste findet ihr hier – viele Funde müssen noch mikroskopisch ausgewertert werden, was natürlich einige Zeit in Anspruch nimmt. Der Beitrg wird später ergänzt.
Catrin
08.05.2025 – Donnerstag
Heute rief mich ein Pilzsammler aus Schwerin an und fragte vorsichtig, ob es denn bei uns in M/V schon Maipilze (Calocybe gambosa) gäbe… Er sammelt seit einigen Jahren Pilze und hat leider noch nie welche gefunden.
Ja – es gibt schon Maipilze. Aber aufgrund der Trockenheit bei weitem nicht so viele wie andere Jahre. An den meisten mir bekannten Standorten zeigt sich nicht ein einziger Fruchtkörper. Nur an 2 Stellen habe ich bisher einige wenige Exemplare gefunden. Und die waren teilweise komplett vermadet.
Pilze sind auf Feuchtigkeit angewiesen und trockene Bedingungen können das Pilzwachstum reduzieren und die Anfälligkeit für Madenbefall erheblich beeinflussen.
Wo findet man Maipilze?
Bei der Wahl seiner Wuchsorte ist der Pilz wenig anspruchsvoll. Maipilze, auch Mairitterlinge genannt, wachsen vor allen auf Wiesen, in Parks, an Waldrändern und auch in Gärten. Aber auch unter Hecken kann man sie finden – besonders unter Wildpflaume, Weißdorn, Rotdorn und Schlehen. Ebenfalls unter Linden sind sie häufig anzutreffen.
Wie kann man Maipilzstandorte finden?
Sie bevorzugen oft naturbelassene, kalkreiche Böden und treten sehr oft in Hexenringen oder Reihen auf. Hexenringe entstehen, da das unterirdische Myzel in alle Richtungen gleichmäßig wächst, was die kreisförmige Struktur erklärt. Am Ende der Myzelfäden bildet sich das, was der Volksmund als „Pilz“ bezeichnet, der sichtbare Fruchtkörper. Da mit der Zeit die Nährstoffe im Boden im inneren Bereich der „kreisförmigen Pilzansammlung“ zur Neige gehen, stirbt das Myzel dort ab und übrig bleibt eine ringförmige Struktur, der sogenannte Hexenring. Auf Rasen oder Wiesen verursachen die Pilze häufig ganzjährig sichtbare dunkle Verfärbungen.
Es sind aber nicht nur Maipilze, die solche Hexenringe verursachen. Ca. 60 verschiedene Pilzarten sind dafür verantwortlich – u.a. auch Nelkenschwindlinge und einige Champignonarten.
Catrin

Hexenringe am 21.04.2025 in einem kleinen Park – Standort der später am 05.05.2025 gefundenen Maipilze. Diese dunkle Färbung entsteht oft durch die Freisetzung von Stickstoff, wenn der Pilz abgestorbenes organisches Material im Boden zersetzt.
Foto: Catrin Berseck

Um Standorte für Pilzarten zu finden, die Hexenringe bilden, kann man auch Google Maps bemühen. Hier Hexenringe im Bürgerpark in Wismar. Welche Pilze dafür verantwortlich sind, weiß ich allerdings nicht…
Foto: Catrin Berseck
10.05.2025 – Sonnabend
Heute fand die Frühjahrstagung der Pilzberater und Pilzsachverständigen aus M/V in Todendorf statt. Viele der 37 in unserem Bundesland tätigen Pilzberater reisten zu dieser Veranstaltung an.
Mecklenburg-Vorpommern ist das einzige Bundesland, das die Pilzberatung als Landesaufgabe im Rahmen des Öffentlichen Gesundheitsdienstes definiert. Die Anleitung und Koordination der ehrenamtlich tätigen Pilzberater erfolgen durch Dr. Duty, den Landespilzsachverständigen (LPS) als Beauftragten des Landesamtes für Gesundheit und Soziales (LAGuS). Die Pilzberatung in M/V obliegt den örtlichen Gesundheits- oder Veterinärämtern.
Wie wichtig die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Pilzberater ist, zeigen einige Zahlen aus dem Jahresbericht:
- Während der ca. 2.200 durchgeführten Beratungen sind 150 stark giftige Pilze aussortiert worden. Darunter befanden sich 41 Grüne Knollenblätterpilze, 52 Pantherpilze, 9 Ziegelrote Risspilze, 3 Frühjahrslorcheln und 45 Gifthäublinge.
- 2024 gab es insgesamt 5 Pilzvergiftungen mit 6 Betroffenen. Am häufigsten waren dabei Vergiftungen mit Karbolegerlingen mit drei Betroffenen, die zum Glück nur geringe Vergiftungssymptome zeigten. Weitere Vergiftungen gab es durch Pantherpilze (1) und Giftschirmpilze (1). Einen besonderen Vergiftungsfall gab es durch den Gewächshaus-Schirmling, der im Blumentopf in der Wohnung gewachsen war und dort von einem 8 Monate alten Säugling gekostet wurde. Zum Glück für alle blieb das folgenlos, obwohl Amanitin labortechnisch, wenn auch in sehr geringer Konzentration, im Urin nachgewiesen werden konnte.
- Neben den sogenannten Echten Pilzvergiftungen gibt es auch immer wieder Vergiftungsfälle durch verdorbene, falsch gelagerte oder nicht ausreichend erhitzte Pilze. In diesem Jahr gab es 4 solcher sogenannten Unechten Pilzvergiftungen.
- Von den weniger giftigen Arten wurden wieder zahlreiche Grünblättrige Schwefelköpfe und Kahle Kremplinge in den Körben entdeckt. Besonders häufig waren in diesem Jahr auch wieder Karbolegerlinge, die körbeweise zu den Beratungen gebracht und dort aussortiert wurden.
Aber die Pilzberater beraten nicht nur – sie kümmern sich auch ehrenamtlich um die Aus- und Weiterbildung. Hier einige Zahlen:
* ca. 40 Ausstellungen mit fast 12.000 Gästen
* über 50 Vorträge mit ca. 1.000 interessierten Personen
* über 220 Pilzlehrwanderungen mit ca. 3.800 Teilnehmern
Anschließend wurde noch der Pilz des Jahres 2025 – die Amethystfarbene Wiesenkoralle vorgestellt. Es gab dann noch einen interessanten Vortrag zum aktuellen Stand der Belastung der Pilze mit Schadstoffen und Radioaktivität nach dem Reaktor-Unfall von Tschernobyl.
Catrin
11.05.2025 – Sonntag
Heute hat Hanjo mal nicht geangelt, sondern ist in den Wald gegangen. Dort fand er am Wegrand trotz der Trockenheit tatsächlich Pilze mit Hut und Stiel.
Es handelt sich um den essbaren Riesen-Träuschling (Stropharia rugosoannulata).
Der Pilz wächst auf verrottenden Pflanzenabfällen, Stroh, Holz- und Rindenhäcksel und Humus und nährstoffreicher Erde. Wir können ihn in Gärten, Parkanlagen, an Straßenböschungen und Wegrändern, auf Strohmieten und Abfallhaufen finden.
Der Riesen-Träuschling ist ein Speisepilz, der seit etwa 1970 auch kultiviert und auf Stroh gezüchtet wird. Er wird unter anderem auch Kulturträuschling, Winnetou, Strohpilz oder Strohzuchtpilz genannt. Im Handel ist er oft als Braunkappe erhältlich.
Der Geschmack dieses Pilzes soll minderwertig sein und es wurde schon häufiger von Unwohlsein oder Magen-Darm-Beschwerden berichtet, vor allem, wenn größere Mengen dieses Pilzes gegessen wurden.
Catrin

Riesenträuschlinge am Standort – davon schon einige Exemplare durch die Trockenheit gezeichnet.
Foto: Hanjo Herbort
14.05.2025 – Mittwoch
Da keine offizielle Mittwochsexkursion auf dem Plan stand, bot Catrin mir an, sie heute Nachmittag an Mecklenburgs höchstgelegenen See und das dort angeschlossene Moor zu begleiten, um nach mykologischen Raritäten oder auch Normalitäten Ausschau zu halten. Zuletzt war ich hier zu meinen Grundschulzeiten und hatte trotz der Wohnortnähe nur noch eine vage Vorstellung von dem Gebiet.
Schon als wir ankamen wurde mir klar, dass ich durch diese Abstinenz ein Juwel in der näheren Umgebung sträflich vernachlässigt hatte. Der Status als Naturschutzgebiet wurde mehr als zu Recht vergeben. Der Schwarze See bei Schlemmin wird nun wohl öfter mal einen Besuch von mir erhalten.
Die um den See angeordneten nährstoffarmen und moosigen Altbuchenbestände, durchsetzt mit Lärchen, Eichen, Fichten und einigen Douglasien, boten eine traumhafte Kulisse.
Oberflächlich war auch hier die Trockenheit allgegenwärtig, unter der mulchenden Laubschicht konnte der Handtest noch immer Feuchtigkeit erfühlen. Da Catrin und ich uns auch dieses Jahr wieder in einem nicht ganz ernst gemeinten Wettbewerb um den ersten Flockenstieligen Hexenröhrling befinden, begleitete uns heute dieses Thema scherzhaft auf unserer Wanderung.

Moorwanderung auf dem Knüppeldamm über den Schwingrasen durch ein Meer von Wollgras.
Foto: Hanjo Herbort
Auch wenn wir hier, wie erwartet, nicht fündig wurden, fanden wir doch neben einigen pflanzlichen Raritäten auch diverse Fruchtkörper von Pilzen. Angefangen bei unzähligen leuchtenden Vertretern aus der Gattung der Schildborstlinge, über kleine, vor Ort nicht bestimmbare Lamellenpilze am Rande eines Sumpfloches oder mitten im Holzpfad durch das Moor, bis hin zu Sklerotienporlingen und sogar Lungenseitlingen (oder doch entflohenen Zuchtausternseitlingen?) gab es auf Schritt und Tritt etwas zu entdecken.
Unser Highlight des Tages war wohl aber der entdeckte Rundblättrige Sonnentau – eine Pflanze, die ich seit meiner Jugend mal finden wollte. Aber auch das Meer aus dem seltenen Wollgras und blühende Callas waren einfach beeindruckend schön. Insgesamt einfach eine tolle Wanderung, die erst zum Einsetzen der Dämmerung endete.
Hanjo (Text), Catrin (Fotoauswahl und Artenliste)

Hier sind die namensgebenden steifen borstenförmige Haare am Rand gut zu erkennen.
Foto: Catrin Beserck

Das Scheiden-Wollgras (Eriophorum vaginatum) ist eine Charakterpflanze der Hochmoore. Mit seinen faserig zerfallenden Blättern trägt das Wollgras wesentlich zur Torfbildung bei. In Hochmoor-Renaturierungen übernimmt es eine wichtige Funktion als Erstbesiedler der vegetationslosen Torfflächen. Die langen Blütenhüllfäden der Früchte bilden den bezeichnenden weißen Wollschopf.
Foto: Hanjo Herbort

Drachenwurz bzw. Sumpf-Calla (Calla palustris). Durch den Rückgang der Feuchtgebiete ist die Pflanze in Teilen von Deutschland heute gefährdet und regional vom Aussterben bedroht. Nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz ist die Art besonders geschützt.
Foto: Hanjo Herbort

Das weiße Hochblatt (Spatha) ist nicht, wie man denken könnte, die Blüte. Der zylindrische Kolben ist dicht mit vielen kleinen Blüten besetzt.
Foto: Hanjo Herbort

Wasserfeder bzw. Wasserprimel (Hottonia palustris). Auch sie ist nach dem deutschen Bundesnaturschutzgesetz und durch die Bundesartenschutzverordnung besonders geschützt und darf nicht aus der Natur entnommen werden.
Foto: Hanjo Herbort

Sumpf-Schwertlilie (Iris pseudacorus). Ebenfalls nach Bundesartenschutzverordnung als besonders geschützt eingestuft.
Foto: Hanjo Herbort

Der Rundblättrige Sonnentau (Drosera rotundifolia) ist eine fleischfressende Pflanze. Die Art ist wie alle in Deutschland vorkommenden Sonnentauarten durch die Bundesartenschutzverordnung geschützt.
Foto: Hanjo Herbort

Die Blätter des Sonnentaus sind mit haarfeinen rötlichen Tentakeln besetzt, die an ihrem Ende ein klebriges Sekret ausscheiden, das zum Fang von Insekten dient. Dabei sind die Tentakeln am Rand deutlich länger als in der Blattmitte.
Foto: Catrin Berseck
17.05.2025 – Sonnabend
Erst einmal kurz zum Wetter. Aktuell ist es über Norddeutschland viel zu trocken, während auch in anderen Teilen Deutschlands der Regen fehlt. In den nächsten ein bis zwei Wochen werden jedoch zunehmend Regengebiete über das Land ziehen.
Ein Tiefdruckgebiet über Polen sorgt für wechselhaftes Wetter und lenkt mit einer Nordströmung feuchte und kühlere Luft nach Mecklenburg-Vorpommern. Es kann gebietsweise vereinzelt zu Schauern kommen, in Vorpommern kann es zeit- und gebietsweise leichten Regen geben.
Heute war eigentlich ein schöner Tag – bis ich gegen 16 Uhr eine Nachricht bekam.
Wie Hanjo ja schon schrieb, haben wir Beide jedes Jahr einen Wettbewerb, wer den ersten Flockenstieligen Hexenröhrling findet. Und wie letztes Jahr war Hanjo wieder der Erste! Ò_Ó
Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist in erster Linie in Rotbuchenwäldern zu finden. Ebenfalls sehr häufig ist er in bodensauren Nadelwäldern, insbesondere in Preiselbeer-Fichten-Tannenwäldern anzutreffen. Der Pilz wächst gern im Randbereich von Mooren. Auf besonders trockenen oder sehr feuchten Böden ist er kaum zu finden.
Der Flockenstielige Hexen-Röhrling ist ein Mykorrhiza-Pilz, der vor allem mit Nadelbäumen, in erster Linie Fichten, in Symbiose lebt. Seltener, meist im Flachland, steht er mit Laubbäumen wie Rotbuchen oder Eichen in Verbindung.
Catrin

Hier sieht man die rot gefärbten Porenenden sowie die namensgebenden Flocken auf dem Stiel.
Foto: Hanjo Herbort

Einen Beweis wollte ich wenigstens haben, damit ich ausschließen konnte, dass Hanjo mir Fotos vom letzten Jahr geschickt hat. <(^.^)>
Foto: Hanjo Herbort
20.05.2025 – Dienstag
Gestern war ich dann auch mal meinen Buchenwald kontrollieren – und habe dort auch ein paar Flockenstielige Hexenröhrlinge (Neoboletus erythropus) gefunden. Trotz des fehlenden Regens ist der Boden unter der dicken Laubschicht noch nicht ganz ausgetrocknet, so dass sich ein paar Exemplare hervorgetraut haben.
Ansonsten zeigt sich auf dem Waldboden aber leider weit und breit kein einziger Pilz mit Hut und Stiel. Außer bei Hanjo – der hat heute tatsächlich den ersten Täubling gefunden.
Mehr Glück hat man derzeit bei der Trockenheit mit baumbewohnenden Pilzen, die die notwendige Feuchtigkeit aus dem Substrat der Bäume ziehen.
So lassen sich derzeit als Speisepilze vorwiegend Schwefelporlinge, Lungenseitlinge, Schuppige und Sklerotienporlinge finden.
Catrin

Violettstieliger Pfirsichtäubling (Russula violeipes) heute von Hanjo im Buchenwald gefunden.
Foto: Hanjo Herbort

Auch Dirk und Martina aus Schwerin sind am Wochenende fündig geworden. Hier noch sehr junge Schwefelporlinge (Laetiporus sulphureus) an einer Weide. In ein paar Tagen sind sie erntereif.
Foto: Dirk Fuhrmann

Der derzeit häufig zu findende Sklerotienporling (Polyporus tuberaster) an Totholz. Ein von Hanjo sehr geschätzter Speisepilz.
Foto: Hanjo Herbort

Getigerter Sägeblättling (Lentinus tigrinus) auf einem Buchenast im moorigen Waldtümpel.
Foto: Catrin Berseck

Hier sehen wir deutlich die namensgebenden gesägten Lamellen des Getigerten Sägeblättlings.
Foto: Catrin Berseck
21.05.2025 – Mittwoch

Am Nordwestufer tritt die Radegast in den Neddersee ein und verlässt diesen nach dem Durchfluss am Südufer wieder.
Foto: Christian Boss
Heute stand die letzte Kartierungsexkursion im Messtischblatt 2232 Gadebusch an. Wie immer standen uns einige interessante Gebiete in diesem Quadranten zur Verfügung.
Wir entschieden uns aufgrund des weiterhin fehlenden Regens wieder für ein Feuchtgebiet – das nordwestliche Ufer des Neddersees nördlich von Gadebusch – der Eintrittstelle der Radegast in diesen See.
Wir – das waren 6 Mitglieder der Gruppe der Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V., die sich bei schönem Frühlingswetter vor Ort trafen.
Da das Ufer des Sees von dichtem Baum- und Strauchwerk und moorigem Untergrund umsäumt ist, begingen wir nur einen kleineren Bereich am Neddersee und der Radegast und besuchten anschließend noch den Gadebuscher Stadtwald, der sich ebenfalls in unserem Kartierungsgebiet befindet.
Einen ausführlichen Bericht über diese Exkursion findet ihr demnächst hier.
Catrin
23.05.2025 – Freitag
Da es kaum Pilze gibt – heute mal Wetter.
Ein Tiefdruckgebiet über Nordeuropa sorgt mit feuchter und kühler Luft für wechselhaftes Wetter. Das hat bereits gestern örtlich zu einigen Regenfällen bzw. sogar Schauern geführt.
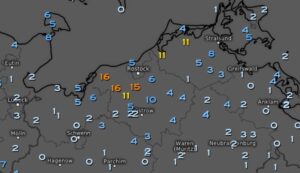
Ergiebige Niederschlagsmengen von über 10 l/m² gab es am 22.05.2025 nur in einem Streifen von Rerik über Satow bis nach Schwaan. Auch entlang der Ostsee von Ribnitz-Damgarten bis nach Barth hat es etwas mehr geregnet.
Quelle: Kachelmannwetter
Auch heute Abend bleibt es wechselnd bis stark bewölkt und es wird weiterhin örtlich Schauer geben.
Am Samstag neben Wolken zeitweise heitere Abschnitte. Die meiste Zeit trocken, vor allem im Küstenumfeld sowie in Vorpommern örtlich Schauer. Höchstwerte zwischen 15 und 18 Grad. In der Nacht zum Sonntag erst teils noch Auflockerungen, im Verlauf von West nach Ost zunehmend stark bewölkt und in Westmecklenburg etwas Regen.
Am Sonntag stark bewölkt bis bedeckt und zeitweise Regen. Am Abend von Westen her Auflockerungen und Übergang zu regionalen Schauern und einzelnen Gewittern.
Auch für nächste Woche ist ähnliches Wetter prognostiziert.
Quelle: Deutscher Wetterdienst
Hoffen wir, dass es die nächsten Tage weiter regnet – und das nicht nur örtlich. Ca. 10 bis 14 Tage nach ausgiebigen Regenfällen kommt das Pilzwachstum erst richtig in Gang.
Ergiebigen Niederschlag gab es letztmalig in Mecklenburg-Vorpommern am 25. Januar 2025 – laut NDR Wetterexperte Thomas Globig. Ähnlich trocken war es hier zuletzt im Frühjahr 1974.
Das hat natürlich auch andere weitreichende Folgen. Zum Beispiel auf die Ernte der Landwirte und Gemüsebauern. Wintergetreide ist im vergangenen September ausgesät worden. Die Saat ist gut durch den milden Winter gekommen, nun benötigen die Pflanzen Wasser. Auch der Raps zeigt bereits Trockenstresssymptome.
Auch Wildtiere und vor allem brütende Vögel leiden unter der Trockenheit. Also hoffen wir, dass es die nächsten Tage ordentlich regnen wird – und das flächendeckend.
Catrin
24.05.2025 – Sonnabend

Schon auf dem Weg in das Waldstück ein in letzter Zeit seltener Anblick – Pfützen auf dem Weg!
Foto: Catrin Berseck
Nachdem es im Raum Bützow/Neukloster wie auch in anderen Gegenden die letzten beiden Tage keine nennenswerten Niederschläge gab, habe ich heute nachmittag nach der Arbeit ein Waldgebiet westlich von Satow aufgesucht. Es liegt genau in dem Gebiet, wo es laut den Messwerten von Kachelmannwetter vor 2 Tagen die stärksten Regenfälle gegeben hat.
Und was soll ich sagen – es stimmt! Schon auf dem Weg dorthin ist mir aufgefallen, dass es in diesem Gebiet richtig ergiebige Schauer gegeben hat.
Etwa 10 bis 14 Tage nach Regen und milden Temperaturen beginnt das Pilzwachstum verstärkt. Ideal ist dabei Regen über mehrere Tage von über 10 l/m², dadurch entsteht eine Erhöhung der Luftfeuchtigkeit, was neben milden Temperaturen das Pilzwachstum fördert.
Catrin

Endlich mal ein Wald, wo das Laub unter den Füßen nicht vor Trockenheit raschelte…
Foto: Catrin Berseck
25.05.2025 – Sonntag
Nachdem die für heute ganztägig angekündigten Regenfälle in meiner Gegend wieder fast ausblieben und nachmittags sogar die Sonne kurz zum Vorschein kam, habe ich mich für einen kurzen Spaziergang in den nahegelegenen Buchenwald begeben.
Eigentlich wollte ich nur nach den letzte Woche gefundenen noch sehr kleinen Schwefelporlingen sehen…
Doch auf dem Weg dort hin überraschten mich tatsächlich mehrere Flockenstielige Hexenröhringe. Einer schöner als der andere…
Nachdem ich Hanjo Fotos geschickt hatte, machte er sich gleich auf den Weg und besuchte den Wald von der anderen Seite. Auch er wurde fündig – fand außerdem noch Täublinge und Sklerotienporlinge.
Das Pilzwachstum beginnt ja eigentlich erst ca. 10 bis 14 Tage nach mehrtägigen ausgiebigen Regenfällen. In guten Buchenwäldern mit lehmigem Boden und vielen Tümpeln und wasserführenden Gräben trocknet der Boden unter der Laubschicht aber nicht so sehr aus. Diese Restfeuchte im Boden bewirkt, dass trotz Trockenheit einige Pilzarten wachsen.
Catrin und Hanjo

Alte überständige Lungen-Seitlinge (Pleurotus pulmonarius). Auch diese werden wir in den nächsten Tagen vermehrt finden können.
Foto: Catrin Berseck

Ganz junger Kastanienbrauner Stielporling (Picipes badius). In der Hutmitte kann man bereits die spätere kastanienbraune Färbung erkennen.
Foto: Hanjo Herbort
28.05.2025 – Mittwoch
Wie man in oben stehender Grafik sehen kann, hat es in Rostock-Warnemünde seit dem 22.05.2025 fast durchgehend mehr oder weniger große Niederschlagsmengen gegeben – der 25.05.2025 hat dabei den meisten Regen gebracht. So ähnlich sieht es in unserem gesamten Bundesland aus.
Auch die folgenden Tage ist bei zunehmenden Temparaturen weiter mit Schauern zu rechnen. Beste Voraussetzungen für ein baldiges Pilzwachstum.
29.05.2025 – Donnerstag (Christi Himmelfahrt)

Gestern traute sich auch schon der erste Perlpilz (Amanita rubescens) aus dem Boden. Hier sind alle wichtigen Merkmale gut erkennbar: rübenartig verdichte Knolle, geriefte Manschette, keine Riefung am Hutrand, rötliche Verfärbung bei Verletzung der Trama und grobschollige grauweiße oder rötlichgraue Velumreste.
Foto: Catrin Berseck
In Deutschland wird auch der Vatertag an Christi Himmelfahrt gefeiert. Diese Tage werden zusammen gefeiert, weil auch Jesus an diesem Tag zu seinem göttlichen Vater in den Himmel aufgestiegen ist
Aber nicht alle Väter ziehen mit Bollerwagen und Bier los – einige verbringen den Tag auch mit ihrer Familie oder es zieht sie bei schönem Wetter in den Wald. So auch Dirk, der einen Ausflug in das Warnowtal gemacht hat. In der Nähe haben wir am Sonnabend unsere Öffentliche Pilzwanderung, so dass wir guter Dinge sein können, einiges an Pilzen zu finden. Auch wenn es vorläufig noch fast nur Baumbewohner sind.
Catrin

Da sage mal noch einer, dass die Schnecken langsam seien… Abgefressene frische Lungenseitlinge (Pleurotus pulmonarius).
Foto: Dirk Fuhrmann
31.05.2025 – Sonnabend
Heute war wieder ein Termin für eine geführte öffentliche Wanderung. Um 9 Uhr trafen sich 8 Pilzinteressierte in Kladow bei Gädebehn, um einen Rundweg durch das Warnowtal zu gehen und nach Pilzen Ausschau zu halten und das Wissen über diese zu erweitern und zu vertiefen.
Unsere Erwartungen bezüglich Frischpilzen hielten sich aufgrund des zu lange ausgebliebenen Regens in Grenzen – wir rechneten eher mit Baumpilzen.
Doch die Überraschung war groß – fanden wir doch einige Vertreter der Großpilze, mit denen wir überhaupt nicht gerechnet hatten.
So hatten wir zum Abschluss des Monats Mai einen schönen Tag bei Sonnenschein in einem landschaftlich reizvollen Gebiet.
Den genauen Bericht inkl. Fundliste findet ihr hier.
Weiter geht es dann mit mehr oder weniger regelmäßigen Berichten in Pilze/Wetter Juni 2025.
Catrin
03.05.2025 – Öffentliche Wanderung im Prosekener Grund
Öffentliche Pilzwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
Durch den Prosekener Grund bei Zierow
Wir haben jetzt schon Mai und befinden uns im Pilzfrühling. Unsere heutige Wanderung führte uns in den Prosekener Grund, einem klassischen Frühlingswald. Der namensgebende Prosekener Bach ist umsäumt von wiesen und Bruchwäldern, die hauptsächlich aus Eschen, Buchen, Ahron und Birken bestehen. Ein klassisches Revier für Morcheln, Morchelbecherlinge und Maipilze, die wir aber heute leider nicht zu Gesicht bekamen.
Zu der heutigen Wanderung fanden sich 11 Pilzinteressierte bei schönem sonnigen Wetter am Treffpunkt ein. Auch wenn es die begehrten Morcheln nicht gab und sich auch viele andere Pilze aufgrund der bereits seit 3 Monaten anhaltenden Trockenheit nicht zeigten, war er doch eine sehr schöne Wanderung, auf der wir wieder einiges an Wissen an die Teilnhmer vermitteln konnten.
Mit leerem Korb ging trotzdem Niemand nach Hause, wie ihr den folgenden Bildern entnehmen könnt.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich zu Beginn unserer Wanderung fanden wir tatsächlich Frischpilze in einer Hecke an Holz. Es handelt sich um Grünblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare), die schon alleine wegen ihres extrem bitteren Geschmacks nicht als Speisepilze in Frage kommen. Sie sind als Giftpilze eingestuft. Seine Giftstoffe (Fasciculole) wirken auf Magen und Dünndarm und lösen Erbrechen sowie Durchfälle aus.
Foto: Catrin Berseck

Gleich danach begrüßte uns ein Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola) mit Guttationstropfen. Bei jungen Fruchtkörpern ist der namensgebende rote Rand noch nicht vorhanden.
Foto: Catrin Berseck

Hier erklärt Catrin den interessierten Teilnehmern anhand eines Fotos die Tropfen am Rotrandigen Baumschwamm. Guttation ist der Vorgang der Abgabe von Wasser in flüssiger Form (Tropfen) insbesondere bei Pflanzen und Pilzen. Guttationstropfen werden von vielen Pilzarten gebildet und enthalten eine Reihe von Substanzen, von denen einige am Holzabbau beteiligt sind.
Foto: Angeli Jänichen

Dann zeigte sich der erste kleine Schuppige Porling (Polyporus squamosus) an einem alten Eschenstubben. Der Pilz riecht auffallend nach Mehl bzw. Gurke.
Foto: Angeli Jänichen

Es sollte nicht der einzige bleiben – im ganzen Uferbereich wimmelte es nur so von Ihnen. Hier sehen wir, wie der Porling einen kleinen Ahornbaum umwächst. Jung sind schuppige Porlinge essbar – im Alter werden sie durch die zunehmend korkig-zähe Konsistenz ungenießbar.
Foto: Angeli Jänichen

Unser jüngster Teilnehmer, der 8-jährige Valentin, freut sich mit seinen Eltern über diesen großen Schuppigen Porling. Auch wenn dieses Exemplar nichts mehr für die Pfanne war.
Foto: Angeli Jänichen

Eine wunderschöne Gruppe Schuppiger Porlinge (Polyporus squamosus) an einer Esche. Wir haben die Pilze übrigens bei unserem Seminar letzte Woche verkostet. Die einhellige Meinung der Teilnehmer war, dass es sich um einen guten Speisepilz handelt.
Foto: Angeli Jänichen

Das ist nicht etwa die Porenschicht der Schuppigen Porlinge. Es ist tatsächlich der von Maden total durchlöcherte Hut – von den Schuppen ist auch kaum noch was zu sehen.
Foto: Angeli Jänichen

Inzwischen wurde fleißig weiter vergeblich nach Morcheln und Morchelbecherlingen gesucht…
Foto: Angeli Jänichen

Und hier sehen wir den kleinen Bruder des Schuppigen Porlings – den Sklerotienporling (Polyporus tuberaster).
Er hat seinen Namen, da er ein Sklerotium ausbildet. Das ist eine bei Pilzen auftretende verhärtete Dauerform. Der Pilz kann lange Zeit in diesem Ruhezustand verharren und beginnt erst bei günstigen Bedingungen wieder zu wachsen oder aus dem Sklerotium Fruchtkörper zu bilden.
Foto: Angeli Jänichen

Die Porenschicht des Sklerotienporlings. Dieser Pilz riecht angenehm pilzig und ist auch ein Speisepilz.
Foto: Angeli Jänichen

Auch am Wegrand bedrüßten uns Pilze. Hier ein Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum) mit seiner schönen weißen Porenschicht.
Foto: Angeli Jänichen

Schmetterlingstrameten (Trametes versicolor). Hier sieht man schön die feinseidegen Hüte, die in vielen Farben gezont sind und an einen bunten Schmetterling erinnern.
Foto: Angeli Jänichen

Kleine Frischpilze fanden wir aber auch. Hier sehen wir einen Rötling sp. (Entoloma sp.) mit einem feinfilzigen Hut, der noch nicht auf Artebene bestimmt wurde.
Foto: Angeli Jänichen

Gleich daneben waren diese beiden Vertreter aus der Gattung der Samthäubchen (Conocybe), die ebenfalls nicht näher bestimmt wurden.
Foto: Angeli Jänichen

Auch den kleinen Phytoparasitischen Pilzen schenkten wir unsere Aufmerksamkeit. Hier Scharbockskrautrost (Uromyces ficariae).
Foto: Catrin Berseck

Und zum Schluss begegneten wir noch diesen wunderschönen Scharlachroten Feuerkäfern (Pyrochroa coccinea). Links sehen wir das Weibchen mit gesägten Fühlern – rechts das Männchen mit gekämmten Fühlern.
Foto: Angeli Jänichen

Unser Abschlussfoto als Erinnerung an eine schöne Frühlingswanderung durch den Prosekener Grund.
Foto: Angeli Jänichen
Die Artenliste aus dem Prosekener Grund im MTB 2034/332
Birnen-Stäubling – alte FK aus Vorjahr (Apioperdon pyriforme), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Eschen-Kohlenbeere (Hypoxylon petriniae), Laubholzharzporling (Ischnoderma resinosum), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Riesenporling – alter FK aus Vorjahr (Meripilus giganteus), Apfelbaum-Feuerschwamm (Phellinus pompceus), Brombeerrost (Phragnidium violceum), Schuppiger Porling (Polporus squamosus), Sklerotienporling (Polyporus tuberaster), Ampferblattrost (Rumularia rubella), Striegelige Tramete (Trametes hirsuta), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Scharbockskrautrost (Uromyces ficariae), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
25.04. bis 27.04.2025 – Frühjahrsseminar in Gallentin
Ein Pilzwochenende in Mecklenburg
Pilzseminar im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
25. – 27. April 2025
Frühjahrsseminar in Gallentin

Das Interesse an unserem diesjährigen Frühjahrs-Seminar war riesengroß – 27 Teilnehmer trafen sich gut gelaunt am 25.04.2027 in Gallentin.
Foto: Angeli Jänichen

Bereits vor 2 Jahren waren wir in Uli´s Kinderland zu unserem Frühjahrs-Seminar.
Foto: Beatrice Seidel

Damit auch jeder Teilnehmer den Weg dort hin findet,..
Foto: Beatrice Seidel
25.04.2025 – Freitag
Das diesjährige Frühjahrsseminar fand nach 2 Jahren wieder in Uli´s Kinderland in Gallentin statt – direkt am Westufer des Schweriner Sees. Uns standen 2 Doppel-Bungalows mit Mehrbettzimmern zur Verfügung, die als Doppel- oder Einzelzimmer durch die Teilnehmer belegt wurden.
Für unser Seminar standen uns der Essensaal sowie ein kleinerer abgetrennter Klubraum zur Verfügung.
Am Freitag reisten die meisten Teilnehmer dann bis 14 Uhr an. Nicht nur aus unserem Bundesland – auch aus dem benachbarten Schleswig-Holstein, Hamburg und Berlin.
Zuerst wurden die Zimmer verteilt und bezogen. Alte Bekannte wurden begrüßt – neue Teilnehmer kennen gelernt.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Nach der Erledigung der Formalitäten gab es erst einmal eine Stärkung mit Kaffee, Tee und mitgebrachtem selbst gebackenen Kuchen.
Foto: Christian Boss

Gegen 14.30 Uhr brachen wir dann zu unserer ersten kleinen Erkundungstour von unserem Objekt in Richtung Bad Kleinen auf.
Foto: Christian Boss

Nicht nur Pilze erregten unser Interesse. Auch den Bäumen widmeten wir unsere Aufmerksamkeit.
Foto: Dirk Fuhrmann

Hier erklären uns Saskia (3.v.l.) und Katrin (rechts), was man alles aus Butterblumen machen kann. Die Löwenzahnwurzel gilt als besonders heilkräftiger Teil des Löwenzahns in der Volksheilkunde.
Foto: Dirk Fuhrmann

Aus der Rinde der alten Weide bricht ein Schwefelporling (Laetiporus sulphureus) hervor.
Foto: Angeli Jänichen

Blick auf den Schweriner See. Wir mussten uns dann langsam auf den Rückweg machen, damit wir den ersten Teil unseres Seminars noch vor dem Abendbrot schaffen.
Foto: Dirk Fuhrmann

Phillipp begann dann den 1. Teil seines Vortrages zur Makroskopischen Pilzbestimmung.
Foto: Dirk Fuhrmann

Hier zeigt Phillip den Teilnehmern schon mal, worauf man bei der Morchelsuche achten sollte.
Foto: Beatrice Seidel

Nach dem Vortrag ging es dann an das Verteilen mitgebrachter und und auf unserer Kurzexkursion gefundener Pilze auf den Tischen. Der Trockenheit geschuldet fiel die Ausstellung dieses mal nicht so üppig aus.
Foto: Hanjo Herbort

Phillip erklärt hier noch einmal im Vortrag besprochene Bestimmungsmerkmale am Pilz selber.
Foto: Dirk Fuhrmann

Im Anschluss beschäftigten sich die Teilnehmer noch mit der mitgebrachten und zur Verfügung gestellten Literatur, versuchten sich selber in der Bestimmung oder konnten – so wie hier Christian aus Berlin – auch mal einen Blick durch das Mikroskop werfen.
Foto: Phillip Buchfink

Für Phillip war auch noch lange nicht Schluss. Er musste seine kleinen Ascomyceten ja noch mikroskopisch bestimmen…
Foto: Beatrice Seidel

Er tauchte nämlich während unserer Kurzexkursion am Nachmittag ständig irgendwo im Schilfgürtel ab…
Foto: Beatrice Seidel

Dabei sammelte er auf Schilf, Seggen, Ästchen, Blättern solche Kleinstpilze ein, die ja auch einem Namen bekommen sollten. Hier sehen wir den Violetten Gallert-Kreisling (Ombrophila violacea).
Foto: Torsten Richter
Die Artenliste vom NW-Ufer des Schweriner Sees zw. Gallentin und Bad Kleinen im MTB 2234/234
Angebrannter Rauchporling (Bjerkanda adusta), Erlenblatt-Stromabecherling (Ciboria conformata), kein deutscher Trivialname (Dennissiodiscus sparganii), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Bartloses Nagelbecherchen (Hymenosyphus imberbis), Rötendes Schilf-Haarbecherchen (Lachnum controversum), Schwefelporling (Laetiorus sulphureus), Hasen-Stäubling – alter FK (Lycoperdon utriforme), „Schilfrohr-Weichbecherchen“ (Mollisia hydrophila), „Schilfrohr-Weichbecherchen“ (Mollisia retincola), Violetter Gallert-Kreisling (Ombrophila violacea), Weiden-Feuerschwamm (Phellinus trivalis), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Ampferblattrost (Rumularia rubella)
26.04.2025 – Sonnabend
Heute stand eine längere Exkursion von Gallentin nach Wiligrad entlang des Schweriner Seeufers an.
Jeder bereitete sich anders auf den Tag vor. Diejenigen, die abends etwas später in´s Bett kamen, schliefen aus. 4 hartgesottene Frauen nutzten den schönen sonnigen Morgen und nahmen schon am frühen Morgen ein erfrischendes Bad im Schweriner See.
Gegen 9 Uhr fanden sich dann alle so langsam zum Frühstück ein und bereiteten ihre Lunchpakete für die anstehende Wanderung vor.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Anschließend versammelten wir uns alle bei strahlendem Sonnenschein zum Start unserer Exkursion.
Foto: Corina Peronne

Es hatten dann auch alle sehr eilig. Demjenigen, der die erste Morchel findet, war eine Flasche Sekt versprochen…
Foto: Beatrice Seidel

Und hier sehen wir Eiman – die glückliche Gewinnerin des Sektes mit einer Minimorchel!
Foto: Angeli Jänichen

Es handelte sich um eine Käppchenmorchel (Morchella semilibera). Hier sehen wir sie direkt neben dem Gewöhnlichen Schuppenwurz (Lathraea squamaria) – einer Morchelanzeiger-Pflanze.
Foto: Beatrice Seidel

So sieht ein Morchelhabitat aus. Fast alle Zeigerpflanzen waren vorhanden. Anemonen, Scharbockskraut und sogar der Aronstab.
Foto: Beatrice Seidel

Auch das Lungenkraut (Pulmonaria officinalis) ist eine Anzeigerpflanze für Morcheln.
Foto: Corina Peronne

So war es auch nicht verwunderlich, dass sich bald die ersten Speisemorcheln (Morchella esculenta) zeigten.
Foto: Angeli Jänichen

Die Speisemorcheln sind Meister im Verstecken. Trotzdem haben wir einige finden können.
Foto: Dirk Fuhrmann

Ein besonders schönes Exemplar unter einer Esche inmitten von Anemonen musste für Phillip als Model fungieren.
Foto: Angeli Jänichen

Und hier das Ergebnis der Foto-Session. Wirklich eine wunderschöne Speisemorchel mit Model-Qualitäten.
Foto: Phillip Buchfink

Da die Speisemorcheln jetzt bereits Erfahrung im Model-Business gesammelt hatten, diente ein Exemplar Sylvina dann später auch noch mal als Vorlage für ein Aquarell.
Foto: Angeli Jänichen

Ein Pilz, der sehr gerne an liegendem Totholz wächst, ist der der Schuppige Porling (Polyporus squamosus).
Foto: Angeli Jänichen

Phillip und Catrin beschließen hier gerade, dass wir ein paar der jungen Exemplare mit nehmen und abends eine Verkostung und Umfrage über den Speisewert machen.
Foto: Hanjo Herbort

Auf unserem weiteren Weg gab es büschelig wachsende Pilze an einem Baumstubben, die Phillip hier erklärt.
Foto: Beatrice Seidel

Es handelt sich um die leicht giftigen Grünblättrigen Schwefelköpfe (Hypholoma fasciculare).
Foto: Angeli Jänichen

Dann begeneten wir noch einigen kleineren Pilzen. Hier sehen den Bescheideten Tintling (Coprinellus ellisii).
Foto und Bestimmung: Phillip Buchfink

Ein weiterer Vertreter aus dieser Gattung ist der Haustintling (Coprinus sp.).
Foto: Phillip Buchfink

Hier sehen wir die leicht keulig angeschwollene und abgesetzte Stielbasis des Haustintlings. Der Fruchtkörper entspringt einem sichtbaren lebhaft rostbraunen, struppigen und sichtbarem Pilzmyzelgeflecht (Ozonium).
Foto: Angeli Jänichen

Im Uferbereich des Sees fanden wir dann an Haselsträuchern den Hasel-Kleiebecherling (Encoelia furfuracea).
Foto: Jürgen Samland

Ältere Laubholz-Harzporlinge (Ischnoderma resinosum) an alten liegenden Buchenstämmen. Es handelte sich hierbei vor einigen Jahren noch um einen seltenen Rote-Liste-Pilz, der sich aber mittlerweile stark ausgebreitet hat.
Foto: Angeli Jänichen

Ebenfalls auf Buche können wir den Kastanienbraunen Porling (Picipes badius) finden. Hier in Gesellschaft des fast überall anwesenden Aronstabes.
Foto: Beatrice Seidel

Hier junge Exemplare, die noch weiß sind und ihre kastanienbraune Färbung erst später annehmen.
Foto: Catrin Berseck

Auf einem Holzstück im Wasser:Getigerter Sägeblättling (Lentinus tigrinus). Namensgebend sind bei diesem Pilz die braun-schwärzlichen haarigen Schüppchen auf dem Hut, die dem Pilz sein charakteristisches, getigertes Aussehen verleihen sowie die „gesägten“ Lamellen.
Foto: Angeli Jänichen

Am Seeufer konnten wir noch andere teilweise seltene Pflanzen bewundern. Hier die Vierblättrige Einbeere (Paris quadrifolia) mit Blüte.
Foto: Angeli Jänichen

Wald-Sanikel (Sanicula europaea) – eine in Nordwestdeutschland sehr seltene vorkommende Pflanze.
Foto: Beatrice Seidel

Wir haben das Schloss Wiligrad fast erreicht. Eine kurze Verschnaufpause, ehe es die vielen Stufen vom Seeufer nach oben geht.
Foto: Corina Perone

Wenn man den Treppenaufstieg vom Steilufer zum Schloss geschafft hat, kann man diesen wunderschönen Blick vom Schlosspark auf den Schweriner Außensee mit der Insel Rethberg – auch Liebesinsel genannt – genießen.
Foto: Hanjo Herbort

Am Schloss angekommen, gönnten wir uns alle erst mal eine längere Pause. Jeder verbrachte sie, wie er Lust hatte. Entweder im Gartencafé, bei einem Spaziergang durch das Gelände oder einfach faul in der Sonne.
Foto: Corina Peronne

Blick auf einen Teil von Schloss Wiligrad. Das Schloss wurde von 1896 bis 1898 im Auftrag des Herzogs Johann Albrecht zu Mecklenburg und seiner Frau Herzogin Elisabeth errichtet. Den Bau und die Einrichtung finanzierte übrigens Herzogin Elisabeth mit dem von ihrer Mutter ererbten Vermögen.
Foto: Hanjo Herbort

Wenn Philipp sein Stativ so hoch aufbaut, fotografiert er mit Sicherheit keine Ascomyceten…
Foto: Corina Peronne

Es wurde unser Gruppenfoto auf den Stufen des Schlosses, bevor wir den Rückweg nach Gallentin antraten.
Foto: Phillip Buchfink
Nachmittags in Gallentin wieder angekommen, machten wir erst einmal Pause.
Einige gingen auf ihre Zimmer, andere tranken Kaffee und aßen Kuchen. Nebenbei wurden die mitgebrachten Schuppigen Porlinge geputzt und mit der netten Köchin vereinbart, dass sie uns die Pilze zu unserem Abendbrot mit zubereitet. Unsere Umfrage zum Speisewert der Schuppigen Porlinge nach dem Essen ergab übringens: 22 x sehr gut, 5 x mittelmäßig.
Die anderen wenigen mitgebrachten Pilze wurden auf die Ausstellung gelegt.
Da aufgrund des fehlenden Niederschlages vorhersehbar war, dass wir nicht so viele Pilze finden werden und die eigentlich anschließend für den Abend geplante Bestimmungsarbeit nur kurz ausfällt, haben wir ganz kurzfristig den Seminarplan geändert.
Wir teilten uns je nach Interessenschwerpunkt in 2 Gruppen auf. Wer wollte, konnte mit Phillip und Catrin üben, mit Pilzbestimmungsschlüsseln zu arbeiten. Alternativ bestand die Möglichkeit, mit Dr. Saskia Görgler von den Kieler Pilzfreunden und Katrin Stolley etwas über Vitalpilze zu lernen.
Ich danke an dieser Stelle noch einmal Saskia und Katrin, dass sie so kurzfristig bereit waren, sich darauf vorzubereiten und diesen Vortrag zu halten.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung)
1. Vortrag Heil- und Vitalpilze
Am Samstag nach dem Abendessen gab es für Interessierte – und das waren die meisten – noch einen Vortrag zu Vitalpilzen. Sie dürfen offiziell nicht Heilpilze heißen, weil es dafür eine Zulassung als Heilmittel geben müsste – Bürokratie lässt grüßen.
Die promovierte Tierärztin Saskia und die Ernährungswissenschaftlerin Katrin warben zunächst dafür, Pilze zu essen – unter Pilz- und Naturfreunden ein Selbstläufer. Dann gaben sie einen kleinen Einblick in ihr umfangreiches Fachwissen zu Vitalpilzen.
Vertieft stellten sie zunächst Reishi vor, den „Pilz der Unsterblichkeit“, nachweisbar seit 4.000 Jahren in der chinesischen Medizin verwendet. Es ging nicht nur um seine diversen medizinischen Wirkungen. Vielmehr erklärte Kathrin auch, wie sie den Pilz selbst züchtet und seine heilenden Inhaltsstoffe nutzbar macht, also letztlich eine Essenz herstellt.
Weiterhin ging es um Chaga, den „König der Heilpilze“. Der Anteil an Antioxidantien, den er enthält, ist kaum zu überbieten. Wir haben selbst erleben können, wie er zerkleinert und gekocht wird. Wichtig ist, dass er nicht mit Metall (Messer, Kochtöpfe usw.) in Kontakt kommen sollte. Anschließend durften wir den hergestellten „Tee“ probieren. Gar nicht so schlecht wie man bei Medizin erwarten müsste, meinten die Teilnehmer.
Auch aus den unscheinbaren und weit verbreiteten Schmetterlingstrameten kann ein „Tee“ hergestellt werden, der begleitend bei verschiedenen Erkrankungen eingesetzt werden kann. Wir haben ihn direkt vor Ort gekocht und am Sonntag zum Frühstück verkostet. Auch der war gut trinkbar.
Der Vortrag schloss mit weiteren Informationen zu Heilwirkungen weiterer Pilze bis hin zu Pilzen, deren Inhaltsstoffe als Psychopharmaka eingesetzt werden können. Bei vielem ist die medizinische Forschung noch im Gange.
Dirk (Text), Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung)
2. Pilze nach Schlüsseln bestimmen (Übungen an praktischen Beispielen)

Mit verschiedener Literatur und den daran enthaltenen unterschiedlichen Schlüsseln wurde versucht, die ausgewählten Pilze zu bestimmen. Dabei ist es zu Anfang von Vorteil, wenn man einen bekannten Pilz dafür nimmt.
Foto: Hanjo Herbort

Aus „Das Kosmos Handbuch Pilze“ ein Auszug aus dem Bestimmungsschlüssel für Röhrlinge. In jedem guten Pilzbuch findet man solche Bestimmungsschlüssel.
Foto: Catrin Berseck
Einige Interessierte blieben bei Phillip und Catrin, um sich mit der ausliegenden umfangreichen Literatur zu beschäftigen und erste Schlüsselungsübungen zu machen.
Pilze zu schlüsseln bedeutet, sie nach bestimmten Merkmalen zu bestimmen und so zu identifizieren. Das geschieht oft mit Hilfe eines Bestimmungsschlüssels, einem Raster von Fragen, die durch Auswahl der zutreffenden Antwort die Identifizierung eingrenzen.
Wie funktioniert das Schlüsseln?
Pilzbestimmungsschlüssel bieten einen strukturierten Weg, Pilze anhand bestimmter Merkmale zu bestimmen. Zu diesen Merkmalen gehören u.a. Hutform, Farbe, Größe, Stiel, Lamellen, Geruch, Geschmack und das Wachstumsumfeld. Durch die Auswahl der zutreffenden Merkmale wird die Anzahl der möglichen Arten schrittweise reduziert, bis im besten Fall nur noch eine Art übrigbleibt.
Leider klappt das nicht bei allen Pilzarten – viele sind mikroskopierpflichtig. Aber es gibt trotzdem genügend Pilze, die auch makroskopisch gut bestimmbar sind – und da kann so ein Bestimmungsschlüssel schon sehr hilfreich sein.

Phillip beschäftigte sich in der Zwischenzeit weiter mit der mikroskopischen Bestimmung seiner Ascomyceten und Tintlinge.
Foto: Hanjo Herbort

Auch Catrin nutzte ihre Chance, von Phillip noch einiges beim Mikroskopieren zu lernen.
Foto: Beatrice Seidel

Anne und Jürgen freuten sich darüber, was man alles unter einer Stereolupe bei 40-facher Vergrößerung entdecken kann. Nicht nur die Pilzstrukturen sind extrem gut zu erkennen – auch ansonsten nicht sichtbare kleine Krabbler und Nematoden erfreuten die Beiden.
Foto: Catrin Berseck
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)
Die Artenliste vom NW-Ufer des Schweriner Sees zw. Gallentin und Schloss Wiligrad im MTB 2234/41
Judasohr (Auricularia auricula-judae), Münzenförmige Kohlenbeere (Biscogniauxia nummularia), Tintenstrichpilz (Bispora antennata), Angebrannter Rauchporling (Bjerkandera adusta), Bräunliches Buchenblatt-Haarbecherchen (Brunnipila fuscenscens), Orangerotes Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Riesenbovist – alter FK (Calvatia gigantea), Erlenblatt-Stromabecherling (Ciboria conformata), Bescheideter Tintling (Copprinellus ellisii), Grauer Faltentintling (Coprinopsis atramentaria), Mahonienrost (Cumminsiella mirabilissima), Hasel-Kleiebecherling (Encoelia furfuracea), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Buchenwaldwasserfuß (Hydroporus subalpinus), Wurzelnder Schleimrübling (Hymenopellis radicata), Grünblättriger Schwefelkopf (Hypholoma fasciculare), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforme), Eschen-Kohlenbeere (Hypoxylon petriniae), Laubholzharzporling (Ischnoderma resinosum), Vielgestaltige Kohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Weißer Haarbecherchen (Lachnum virgineum), Getigerter Sägeblättling (Lentinius tigrinus), Riesenporling – alter FK (Meripilus giganteus), „Sumpfseggen-Weichbecherchen“ (Mollisia asteroma), Speisemorchel (Morchella esculenta), Käppchen-Morchel (Morchella semilibera), Brombeerrost (Phragnidium violaceum), Kastanienbrauner Stielporling (Picipes badius), Krauser Adernzähling (Plicatura crispa), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Löwengelber Schwarzstielporling – alter FK (Polporus leptocephalus), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Rhododendronknospen-Fresserpilz (Pycnostysanus azaleae), Ampferblattrost (Ramularia rubella), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Striegelige Tramete (Trametes hirsuta), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Rostpilz an Scharbockskraut (Uromyces ficariae)
27.04.2025 – Sonntag
Heute war der letzte Tag unseres Frühjahrsseminares.
Nach dem Frühstück wurden die Zimmer geräumt und Autos gepackt. Einige wenige Teilnehmer verabschiedeten sich und fuhren nach Hause, da sie noch andere Termine hatten oder eine weite Heimreise.
Eigentlich hatten wir für unsere Abschlussexkursion den Jesendorfer Forst vorgesehen. Aufgrund der Trockenheit keine gute Idee. Wir entschieden uns dann den Abend zuvor, das Görslower Ufer am Ostufer des Schweriner Sees aufzusuchen. Hier standen uns auch genügend Parkplätze für die vielen Autos zur Verfügung.
Bea und Christian aus Berlin hatten während ihres Urlaubs in dieser Woche den Bereich in Richtung Leezen bereits erkundet und auch Morcheln gefunden. Wir entschieden uns deswegen in Richtung Raben Steinfeld zu gehen.

Und dann fanden wir mitten auf dem Weg zur Freude Aller tatsächlich noch eine Gruppe von frischen Maipilzen (Calocybe gambosa).
Foto: Angeli Jänichen

Sylvina nahm einige Exemplare mit nach Hause und hielt sie als Erinnerung an diese Exkursion wieder als Aquarell fest.
Foto: Sylvina Zander

An einer Buche wuchsen sehr weit oben dieses Büschel Schüpplinge (Pholiota sp.).
Foto: Angeli Jänichen

Für den Rückweg wählten wir den oberhalb der Steilhänge entlang führenden Wanderweg.
Foto: Beatrice Seidel

An einem Buchenstamm entdeckten wir diese bereits vertrockneten Orangeseitlinge ( Phyllotopsis nidulans). Frisch finden wir ihn in leuchtenden Orangetönen in den Wintermonaten vom Spätherbst bis in den Frühling.
Foto: Angeli Jänichen

Hier noch einmal ein Blick durch die Bäume oberhalb des Steilhanges auf das am anderen Ufer liegende Schweriner Schloss.
Foto: Dirk Fuhrmann

Dieser von Misteln übersäte Baum steht auf dem eingezäunten Gelände des Stasi-Unterlagenarchives in Görslow.
Foto: Beatrice Seidel
Gegen 13 Uhr beendeten wir unsere Wanderung und traten die Heimreise an.
Wir – vor allem Phillip, Catrin und die anderen fleißigen Helfer aus dem Verein – möchten uns noch einmal bei allen Teilnehmern bedanken. Wir waren mit 27 Personen eine große – aber trotzdem harmonische Gruppe. Jeder hat seinen Beitrag dazu geleistet und sich eingebracht – sei es durch seine Kenntnisse über Pflanzen, Bäume, Tiere oder andere interessante Themen.
Schon das alleine hat uns die Arbeit und Zeit, die wir in die Vorbereitung und Durchführung des Seminars investiert haben, vergessen lassen.
Besonders bedanken möchten wir uns an dieser Stelle noch einmal bei Saskia und Katrin, die 1 Woche vor Seminarbeginn noch ihren Vortrag vorbereitet haben und damit auch zum Gelingen dieser Veranstaltung beigetragen haben.
Auch den netten Mitarbeitern aus Uli´s Kinderland gebührt unser Dank. Sie haben unsere Wünsche erfüllt und ebenfalls dazu beigetragen, dass wir dort 3 schöne Tage verbringen konnten.
Wir freuen uns bereits auf eine rege Teilnahme an unserem Herbstseminar.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)
Die Artenliste vom Östlichen Uferbereich des Schweriner (Innen) Sees am Görslower Ufer Ri. Raben Steinfeld im MTB 2234/424
Judasohr (Auricularia auricula-judae), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum)
Quadrantenwechsel innerhalb des Exkursionsgebietes
Die Artenliste vom Östlichen Uferbereich des Schweriner (Innen) Sees am Görslower Ufer Ri. Raben Steinfeld im MTB 2335/313
Münzenförmige Kohlenbeere (Biscognauxia nummularia), Maipilz (Calocybe gambosa), Eichenwirrling (Daedales quercina), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Buchenwaldwasserfuß (Hydroporus subalpinus), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxylon fragiforne), Eschen-Kohlenbeere (Hypoxylon petriniae), Laubholzharzporling (Ischnoderma resinosum), Schwefelporling (Laetiporus sulphureus), Kiefernnadel-Spaltlippe (Lophodermium pinastri), Kiefernschütte-Spaltlippe (Lophodermium seditiosum), Orangeseitling – alte FK (Phyllotopsis nidulans), Rehbrauner Dachpilz (Pluteus cervinus agg.), Striegelige Tramete (Trametes hirsuta), Schmetterlingstramete (Trametes versicolos)
23.04.2025 – MTB 2232/2 bei Kirch Grambow
23.04.2025 – Mittwochsexkursion
Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch
Auch für interessierte Pilzfreundinnen und Pilzfreunde
MTB 2232/2 – Wedendorfer See bei Kirch Grambow

Blick auf den Wedendorfer See aus Richtung Kirch Grambow. Das naturnahe Seeufer ist fast vollständig von einem Schilfgürtel umgeben, an dem sich überwiegend ein Laubwaldgürtel und ausgedehnte Feucht- bzw. Grünlandflächen anschließen.Foto: Christopher Engelhardt
Der zweite Quadrant des Messtischblatts Gadebusch stand an. Ende April ist die Natur langsam erblüht – aber an der Pilzfront tat sich aufgrund der langanhaltenden Trockenheit leider noch nicht so viel. Dementsprechend waren unsere Erwartungen auch nicht sehr hoch.
Ist es nicht zu trocken oder kalt, ist Ende April eine gute Zeit, sich nach den heißbegehrten Morcheln umzusehen. Der 2. Quadrant umfasst das Gebiet zwischen Köchelstorf, Othenstorf und Botelsdorf. Zu den genannten Morcheln sei gesagt: Es gibt sie auf jeden Fall in diesem Bereich! Wo genau wird natürlich nicht verraten.
Es geht bei den Mittwochsexkursionen allerdings nicht nur um Speisepilze, sondern um alle Pilzarten, die wir finden können, um diese zu kartieren. Interessante Bereiche für die Exkursion boten sich reichlich. Zum einen war das Düsterhorn eine Option. Das Waldgebiet zwischen Othenstorf und Wedendorf war in den letzten Jahren schon einmal Ziel einer geführten Wanderung.
Wir entschieden uns aber aufgrund der Trockenheit für das nördliche Ufer des Wedendorfer Sees und begannen unsere Exkursion beim Friedhof in Kirch Grambow. Friedhöfe sind manchmal lohnende Bereiche, wenn es um interessante und seltene Pilzarten geht.
Wir – das waren insgesamt 11 Teilnehmer des Pilvereins der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. sowie Torsten Richter vom Pilzverein „Heinrich Sternberg“ Rehna e.V.. Unsere Vereinsmitglieder Bea und Christian aus Berlin, die gerade Urlaub in Schwerin machten, ließen es sich nicht nehmen, an dieser Kartierungs-Exkursion teilzunehmen. Am Ende konnten wir wieder fast 50 Pilzarten finden und für die Kartierung bestimmen und aufschreiben.
Auch in diesem Beitrag möchten wir euch einige meist nicht beachtete Kleinpilze nicht vorenthalten, die Torsten Richter nachträglich mikroskopisch bestimmt hat und uns die wunderschönen Fotos zur Verfügung gestellt hat.
Catrin (Text, Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Dieses mal machten wir unser obligatorisches Foto gleich zu Beginn der Exkursion. Der Backsteinbau der Kirche in Kirch Grambow aus dem 13. Jahrhundert mit seinem Fundament aus Feldsteinen bot eine super Kulisse.
Oben v.l.n.r.: Maria, Chris, Torsten, Bea
Unten v.l.n.r.: Angeli, Catrin, Sylvina, Phillip, Christian, Michael
Foto: Angeli Jänichen

Und los ging es vom Friedhof in Richtung See. Was Michael da wohl gefunden hat?
Foto: Angeli Jänichen

Es handelte sich tatsächlich um den ersten Morchelbecherling (Disciotis venosa), den wir dieses Jahr zu Gesicht bekamen. Ein trotz des Chlorgeruches wohlschmeckender Speisepilz, der der Speisemorchel in nichts nachsteht. Selbst die Weinbergschnecke zog bei dem Chlorgeruch ihre Fühler ein, mit denen sie nicht nur sehen, sondern tatsächlich auch riechen kann.
Foto: Angeli Jänichen

Weiter ging es in den Uferbereich, wo uns bereits „Morchelanzeiger-Pflanzen“ begrüßten. Hier Hohler Lerchensporn (Corydalis cava).
Foto: Christopher Engelhardt

Nach diesen Morchelanzeiger-Pflanzen ließ der Fund der ersten Käppchenmorchel (Morchella semilibera) inmitten von Scharbockskraut (Ficaria verna) – einem weiteren Morchelanzeiger – nicht lange auf sich warten.
Fotos: Beatrice Seidel

Und es sollte nicht die einzige Käppchenmorchel bleiben, die sich im Uferbereich finden ließen. Die Käppchenmorchel wird auch Halbfreie Morchel genannt. Merkmale sind ein hohler Stiel, der mit dem Hut zu einem Drittel verwachsen ist (halbfrei) und einem meist zugespitzten Käppchen.
Foto: Angeli Jänichen

Es handelte sich dabei um den Braunhaarigen Scheibchentintling (Parasola auricoma).
Foto und Bestimmung: Phillip Buchfink

An dem kleinen Exemplar rechts unten kann man sehr gut auf dem Hut die namensgebenden winzigen braunen Härchen (Setae) sehen.
Foto und Bestimmung: Phillip Buchfink

Danach sind Torsten und Phillip dann erst einmal „abgetaucht“, um sich ihren heiß geliebten Ascomyceten (Schlauchpilze) im Schilf- und Uferbereich zu widmen.
Foto: Angeli Jänichen

An äußeren Blattscheiden von Ufer-Segge (Carex riparia) kann man „Ufer-Seggen Weichbecherchen“ (Mollisia pilosa) finden.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Hingegen lassen sich an den äußeren Blattscheiden der Sumpf-Segge (Carex acutiformis) „Sumpf-Seggen Weichbecherchen“ (Mollisia asteroma) finden.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Und auch an feuchtliegenden Schilfrohr-Stängeln (Phragmites) kann es kleine Pilzchen geben. Hier das „Sumpf-Weichbecherchen“ (Mollisia palustris).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Aber nicht nur im Schilfgürtel sind Torsten und Phillip fündig geworden. Auch im morastigen Bereich lassen sich mit scharfem Blick Kleinstpilze auf feucht liegenden Ästen, Zweigen oder verrottenden Fruchtkörpern von Bäumen finden.
Foto: Angeli Jänichen

Erlenblatt-Stromabecherling (Ciboria conformata) an skelettierten Erlen-Blättern (Alnus cf).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Weißbleibendes Laubholz-Haarbecherchen (Lachnum pudibundum) an feuchtliegenden Weiden-Ästchen (Salix)
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Grevilles Warzen-Haarbecherchen (Cistella grevellei) an vorjährigen Stängelresten vom Wolligen Hahnenfuß (Ranunculus lanuginosus). Dieser Pilz wurde nach Robert Kaye Greville (1794 -1866), einem britischen Botaniker und Mykologen benannt.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

An einem Ast der Roßkastanie hat Torsten dann auch noch die Violette Schneckenbasidie (Helicobasidium brebissonii) gefunden.
Es handelt sich um eine Pilzart aus der Familie der Ohrlappenpilzverwandten (Auriculariaceae). Die Fruchtkörper der fast weltweit verbreiteten Art sind rosa-violett, filzig bis membranös und resupinat. Der Pilz wächst parasitisch an Stämmen, Wurzeln und Rinden von Bäumen, Kräutern und Sträuchern, vor allem in Erdbodennähe.
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Wurzelfäule auf Karotte verursacht durch die Violette Schneckenbasidie. In der Landwirtschaft als Violetter Wurzeltöter bekannt, richtet der Pilz vor allem im Anbau von Zuckerrüben, Karotten, Luzernen und Kartoffeln Schaden an.
Quelle und Foto: Wikipedia

Auch diesen Fund und das grandiose Foto von Torsten wollen wir euch nicht vorenthalten. Ihr seht hier einen Pustelpilz (Dialonectria diatrypicola) , der auf dem Blasigen Eckenscheibchen (Diatrype bullata) fruktiziert. Das ganze an Grauweide-Ästen (Salix cinerea).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Aber nicht nur Kleinstpilze sind im feuchten morastigen Bereich zu finden. Hier sehen wir den Steifstieligen Tintling (Coprinellus hiascens).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Jetzt erst einmal genug von den Ascomyceten… Die anderen wanderten inzwischen ohne Gummistiefel den befestigten Weg entlang.
Foto: Angeli Jänichen

Auch hier gab es Interessantes zu entdecken – uns interessiert ja alles in der Natur. Violetter Ölkäfer (Meloe violaceus).
Foto: Christopher Engelhardt

Auch Speisepilze zeigten sich auf unserem weiterem Weg Richtung Schloss Wedendorf. Hier sehen wir den Schuppigen Poring (Polyporus squamosus) an einer Kastanie.
Foto: Angeli Jänichen

Dann erreichten wir Schloss Wedendorf. Die Anlage wurde 1697 für Andreas Gottlieb von Bernstorff errichtet. Das denkmalgeschützte Schloss wurde saniert und befindet sich im Privatbesitz.
Foto: Beatrice Seidel

Und hier wurde es noch einmal richtig interessant! Torsten bringt seine Kamera in Stellung…
Foto: Angeli Jänichen

Endlich Pilze mit Hut und Stiel! Der Behangene Faserling (Psathyrella candolleana) unter einer Schwarzpappel (Populus nigra).
Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Gleich in unmittelbarer Nähe waren dann noch diese Faserlinge bzw. Mürblinge (Psathyrella sp.), die leider nicht auf Artebene bestimmt werden konnten.
Foto: Phillip Buchfink

Wir traten dann den Rückweg an – und da fand Christian dann tatsächlich noch auf der Wiese Maipilze (Calocybe gambosa). Er wird auch Mai- bzw. Georgsritterling genannt und ist, von den Morcheln abgesehen, der Klassiker unter den Frühjahrspilzen. Sein Name ist etwas irreführend. Denn nicht erst im Mai, sondern meist schon um den 23. April herum erscheinen diese wohlschmeckenden Pilze. Punktlandung! Genau heute am 23. April ist der Georgstag zu Ehren des Heiligen Georg, des urchristlichen Märtyrers. So wurde der Mairitterling auf den botanischen Namen Tricholoma georgii getauft. Im Volksmund hielt sich lange der Name Georgs- oder Georgi-Ritterling. Da der Pilz aber gar nicht zu den Ritterlingen gehört, sondern zur Gattung der Schönköpfe, wurde er schließlich in Calocybe gambosa umbenannt.
Foto: Maria Schramm
Die Artenliste vom nördlichen Teil des Wedendorfer Sees bei Kirch Grambow im MTB 2232/232
Judasohr (Auricularia auricula-judae), Münzenförmige Kohlenbeere (Biscogniauxia nummularia), Orangefarbenes Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Maipilz (Calocybe gambosa), Erlenblatt-Stromabecherling (Ciboria conformata), Grevilles Warzen-Haarbecherchen (Cistella grevellei), Steifstieliger Tintling (Coprinellus hiascens), Pokalförmiger Krönchenbecherling (Cyathicula cathoides), Rötende Tramete (Daedaleopsis confragosa), Holzkohle-Kugelpilz (Daldinia concentrica agg.), kein deutscher Trivialname (Dennisiodicus ripariae nom. prov. Baral), „Eckenscheibchen-Pustelpilz“ (Dialonectria diatrypicola), Blasiges Eckenscheibchen (Diatrypella bullata), Buchen-Eckenscheibchen (Diatrype disciformis), Aderiger Morchelbecherling (Disciotis venosa), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Violette Schneckenbasidie (Helicobasidium brebessonii), Bartloses Nagelbecherchen (Hymenoscyphus imbernis), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxlon fuscum), Eschen-Kohlenbeere (Hypoxlon petriniae), Vielgestaltige Holzkohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Weißbleibendes Laubholz-Haarbecherchen (Lachnum pudibundum), Winterstiel-Porling (Lentinus brumalis), Zugespitzter Kugelpilz (Leptosphaeria acuta), Blutmilchpilz (Lycogala epidendrum), Käppchen-Morchel (Morchella semilibera), „Sumpf-Seggen-Weichbecherchen“ (Mollisia asteroama) , „Sumpf-Weichbecherchen“ (Mollisia palustris), „Ufer-Seggen-Weichbecherchen“ (Mollisia pilosa), Kerndrüsling (Myxarium nucleatum), Braunhaariger Scheibchentintling (Parasola auricoma), Rostbrauner Feuerschwamm (Phellinus ferruginosus), Krauser Adernzähling (Plicatura crispa), Schuppiger Porling (Polyporus squamosus), Sklerotienporling (Polyporus tuberaster), Behangener Faserling (Psathyrella candolleana), Wollbecherchen (Psilachnum acutum), Kastanienbrauner Moschuskrautrost (Puccinia adoxae), Giersch-Rost (Puccinia-aegopodii), Buckeltramete (Trametes gibbosa), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Scharbockskraut-Rost (Uromyces ficariae), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata), Buchenfruchtschalenholzkeule (Xylaria carpophila), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
Pilze und Wetter April 2025
Wetter und Pilzwachstum in Mecklenburg
Tagebuch zu Pilze und Wetter im April 2025

Bereits im Februar haben sich die farbenfrohen Österreichischen Prachtbecherlinge (Sarcoscypha austriaca) zu voller Pracht entwickelt. Standortfoto vom 24.02.2025 von Catrin Berseck
01.04.2025 – Dienstag

Auch die seltenen Glänzenden Schwarzborstlinge (Pseudoplectania nigrella) zeigten sich bereits im Januar am bekannten Standort unter Fichte. Standortfoto vom 08.02.2025 von Catrin Berseck
Es ist wieder soweit – wir starten in das Pilzjahr 2025!
Zuerst zum Wetter – natürlich nicht so ausführlich und kompetent, wie Reinhold uns das immer präsentiert hat … Äußerst trocken zeigten sich die vergangenen beiden Monate in ganz in Mecklenburg-Vorpommern. Gerade einmal 8 l/m² und das verteilt auf 3 bis 6 Tage kamen im März vom Himmel. Damit gehörte Mecklenburg-Vorpommern zu den niederschlagsärmsten Bundesländern. Nach 12 l/m² im Februar war es also der zweite viel zu trockene Monat in Folge seit Messreihenbeginn. Die vieljährigen Mittelwerte liegen bei ca. 40 l/m² Regen pro Monat. (Quelle: Deutscher Wetterdienst).
Natürlich haben diese Trockenheit und die teilweise nächtlichen Temperaturen in Gefrierpunktnähe bei uns auch Auswirkungen auf das Pilzwachstum. Konnten wir letztes Jahr Anfang April bereits Morcheln, Lorcheln und Maipilze finden, werden wir uns dieses Jahr gedulden müssen.
Vor allem ist Regen wichtig – schließlich findet unser diesjähriges Frühjahrsseminar Ende April in Gallentin statt. Und auf dieser Lehrveranstaltung wollen wir ja Einiges finden und erklären, damit es keine „Leerveranstaltung“ wird.
Catrin
05.04.2025 – Sonnabend
Pünktlich am ersten Aprilwochenende des Jahres fand unsere erste Öffentliche Pilzwanderung statt. Ziel war der Tarnewitzer Urwald bei Boltenhagen. Den genauen Bericht inkl. Fundliste findet ihr hier.
Catrin
09.04.2025 – Mittwoch
Traditionell mittwochs brachen wir in der Vergangenheit immer zu unseren sogenannten Mittwochs- und Kartierungsexkursionen auf. Daran aoll sich auch dieses Jahr nichts ändern – allerdings nur noch im 2-wöchigen Abstand. Heute war es dann endlich soweit. Ziel dieser ersten Kartierung ist das Messtischblatt 2232 Gadebusch. Wir starteten im ersten Quadranten südlich von Rehna im Radegasttal.
Eindrücke von dieser Exkursion inkl. Fundbericht findet ihr hier.
Catrin
16.04.2025 – Mittwoch
Heute Abend fand eine Vorstandssitzung der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. in Wismar statt. Es waren noch einige wichtige vertragliche und organisatorische Dinge zu klären.
Dorit aus Ratzeburg, die Beisitzer im Vorstand ist und an der Sitzung auch teilgenommen hat, kannte den Seeblickpark in Wismar bisher nur aus Reinholds Erzählungen und Tagebuchbeschreibungen. Also habe ich kurzfristig im Anschluss an die Sitzung beschlossen, ihr den Park zu zeigen. Aufgrund des immer noch fehlenden Regens war natürlich nicht ein einziger Frischpilz mit Hut und Stiel zu sehen.
Um so mehr haben wir uns gefreut, an dem mir bekannten Standort die bereits riesigen Schuppigen Porlinge vorzufinden. Als Folgezersetzer und Weißfäuleauslöser sind diese Pilze nicht so auf den Regen angewiesen, da sie sich von dem Baum bzw. in diesem Fall vom Totholz ernähren, die noch genug Restfeuchte gespeichert haben.
Reinhold hatte diese imposanten Exemplare jedes Jahr für seine Ausstellung geholt. Natürlich durften die Pilze heute an Ort und Stelle verbleiben.
Catrin
19.04.2025 – Sonnabend
Dorit und ich haben den schönen sonnigen Tag genutzt, um einen Ausflug in das Warnowtal bei Gädebehn zu machen. Mit vielen Pilzfunden haben wir aufgrund der weiter anhaltenden Trockenheit nicht gerechnet – haben uns aber über nachfolgend ausgewählte Funde sehr gefreut.
Catrin

Junge Schüpplinge (Pholiota sp.) an zum Abtransport gestapelten Buchenstämmen. Die Pilze verblieben dort und werden erst zu unserem Frühjahrs-Seminar in Gallentin zur genaueren Bestimmung geholt. Foto: Dorit Meyer
21.04.2025 – Ostermontag Sie sind da! Morcheln und erste Maipilze lassen sich sehen.
Der Monat war bislang deutlich zu trocken. Hochdruckeinflüsse dominierten das Wettergeschehen, was zu viel Sonnenschein, aber auch zu Trockenheit führte.
Frühjahrspilze wie Morcheln, Lorcheln und Maipilze brauchen feuchte Böden, milde Temperaturen und hohe Luftfeuchtigkeit. Wenn der Boden austrocknet, bleiben die Fruchtkörper „im Boden stecken“ oder erscheinen gar nicht. Wiesenpilze finden sich nur punktuell: in feuchteren Senken, in Gärten oder an Stellen mit Bodenfeuchte durch Tau. Wenn man aber ganz dicht am Rand von Gewässern sucht, z.B. am Schweriner See, lassen sich vielleicht doch einige Frischpilze ausmachen.

Statt der Ostereier ließen sich in Wiligrad Speisemorcheln (Morchella esculenta) finden. Sie standen fast direkt an der Uferlinie unter Erlen und Buchen, so ziemlich der einzige einigermaßen feuchte Bereich in dem Waldgebiet. Foto: Maria Schramm

Sie wurden auch gleich geputzt und verzehrt. Hier sieht man nochmal gut ihre Größe und die dicken Füße. Foto: Maria Schramm

Rostocker Spitzmorchel (Morchella elata) – wegen des Substrats auch Rindenmulchmorchel genannt.
Foto: Irina Gräber
Und auch Irina aus Rostock, die sonst Morcheln auf einer Streuobstwiese findet, war diesmal in Rostock auf Rindenmulch fündig geworden. An „guten Stellen“ erscheinen Morcheln auch in trockenen Jahren. Diese „Morchelplätze“ liefern manchmal trotz schlechtem Wetter eine kleine Ernte, sofern die Bodenstruktur stimmt.
Kurz vor dem Georgstag zeigten sich in Hanjos Garten nun die ersten Maipilze — auch Mai- oder Georgsritterlinge genannt. Maipilze brauchen milde Nächte, wie wir es in den letzten Tagen hatten, und ein wenig Wärme. An feuchteren, schattigen Plätzen können wir also jetzt mit den ersten Exemplaren rechnen. Auf offenen, trockenen Wiesen dauert es vermutlich noch ein paar regnerische Tage, bevor sie massenhaft erscheinen.
Aber laut Wettervorhersage beträgt die erwartete Regenmenge für die nächsten sieben Tage insgesamt weniger als 2 mm. Der Dienstag, 22. April soll einige Schauer mit einer Regenwahrscheinlichkeit von etwa 65 % bringen. An den darauffolgenden Tagen bleibt es wieder überwiegend trocken, mit nur vereinzelten leichten Schauern und eher geringen Regenmengen.
Maria

In Hanjos Garten erblickten die ersten Maipolze (Calocybe gambosa) das Licht der Welt. Über Regen würden sie sich freuen.
Foto: Hanjo Herbort
23.04.2025 – Mittwoch
Es war wieder soweit – die nächste Kartierungsexkurion im Messtischblatt Gadebusch stand an. Um 15.30 Uhr trafen sich 11 motivierte Pilzfreunde zu unserer zweiten Kartierungsexkursion in Kirch Grambow und wanderten am Nordufer des Wedendorfer Sees in Richtung Schloss Wedendorf. Es hat wie immer Spaß gemacht und einige schöne Funde konnten auf unsere Kartierungsliste aufgenommen werden.
Eindrücke von dieser Exkursion inkl. Fundbericht findet ihr hier.
Catrin

Auf unserer Kartierungsexkursion im 2. Quadranten des MTB 2232 bei Schloss Wedendorf. Auch das gibt es mal auf unseren Exkursionen – Ratlosigkeit und fragende Blicke… Diese hier gefundenen Mürblinge (Psathyrella sp.) konnten auch von Phillip im Nachhinein nicht mikroskopisch auf Artebene bestimmt werden.
Foto: Beatrice Seidel
25.04. – 27.04.2025 – Freitag bis Sonntag Frühjahrsseminar in Gallentin

Frühjahrsseminar 2025 in Gallentin – während unserer Exkursion am Schweriner See
Foto: Christian Petzka
Auch an dieser Tradition halten wir fest – jeweils im Frühjahr und im Herbst finden unsere Seminare für pilzinteressierte Anfänger als auch Fortgeschrittene statt.
Ziel unseres diesjährigen Frühjahrsseminares war nach 2 Jahren wieder Uli´s Kinderland in Gallentin direkt am Westufer des Schweriner Sees. Bereits kurz nach unserer Ankündigung unter Termine 2025 war das Seminar komplett ausgebucht. Das Interesse war groß – mit 27 Teilnehmern eine Rekordbeteiligung! Wir waren eine sehr harmonische Gruppe aus Altbekannten und Neulingen, so dass wir ein sehr schönes lehrreiches Wochenende hatten.
Im Vorfeld hatten wir ein interessantes Programm aus Theorie und Praxis zusammengestellt. Sorge machte uns allerdings die bereits seit Wochen anhaltende Trockenheit und dass dadurch ausbleibende Pilzwachstum. Aber wir sollten nicht enttäuscht werden. Bei wunderbarem sonnigen Frühjahrswetter konnten wir trotzdem Einiges finden und bestimmen.
Vor allem waren die Morcheln pünktlich zur Stelle, so dass dieses Seminar als „Morchelseminar“ allen Teilnehmern in guter Erinnerung bleiben wird.
Einen ausführlichen Bericht inkl. Fundlisten findet ihr hier.
Catrin

Eine der auf unserem Frühjahrsseminar gefundenen Speisemorcheln – hier als Aquarell von Sylvina Zander festgehalten
Foto: Sylvina Zander
09.04.2025 – MTB 2232/1 – Radegasttal südlich von Rehna
09.04.2025 – Mittwochsexkursion
Mittwochsexkursion im Messtischblatt Gadebusch
Auch für interessierte Pilzfreundinnen und Pilzfreunde
MTB 2232/1 – Radegasttal südlich von Rehna

Ziel unserer ersten Mittwochs- und Kartierungsexkursion 2025 war das Radegasttal südlich von Rehna. Hier sehen wir schön den gewundenen Verlauf der Radegast, die sich in Mäanderform durch das namensgebende Radegasttal schlängelt. Foto: Angeli Jänichen
Auch in diesem Jahr starteten wir wieder traditionell zu unseren Mittwochsexkursionen. Dabei geht es nicht in erster Linie um das Erkennen und Sammeln neuer Speisepilze, sondern es sind Kartierungsexkursionen. Wir streifen durch ein beliebiges Gebiet, schauen uns um und notieren alle Pilzarten, die uns vor die Nase kommen. Dabei kann man natürlich jede Menge lernen und somit sind natürlich auch Gäste herzlich willkommen.
Ausgelost wurde als erstes für 2025 das Messtischblatt 2232 – Gadebusch. Wie gewohnt wird dieses Messtischblatt durch 4 Quadranten geteilt. Diesen Mittwoch ging es also in den ersten Quadranten. Dieser umfasst die Gebiete rund um Rehna. Ausgedehnte Waldgebiete haben wir hier kaum, allerdings ist das Anfang April auch gar nicht nötig. Besonders in feuchteren Bereichen kann es sehr interessant werden.
Die Radegast mäandert beispielsweise durch den gesamten Quadranten von Süd nach Nord. Die Randbereiche können zu dieser Zeit sehr interessant sein. Und genau aus diesem Grund entschieden wir uns für dieses Gebiet.
Wir durchstreiften dabei einen sumpfigen Teil mit vorwiegend Erlen, Pappeln, Birken mit viel Totholz. Dabei streiften wir auch einen trockenen Nadelholzbereich.
Wir – das waren insgesamt 8 Teilnehmer des Pilvereins der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V. sowie Torsten Richter vom Pilzverein „Heinrich Sternberg“ Rehna e.V., der es sich nicht nehmen ließ, uns in seinem Heimatrevier mit seinem umfangreichen Fachwissen tatkräftig zu unterstützen. Am Ende dieser schönen und sehr lehrreichen Exkursion konnten wir fast 50 Pilzarten finden und für die Kartierung bestimmen und aufschreiben.
Da wir Torsten Richter als Experten für Kleinpilze mit dabei hatten, wollen wir in diesem Beitrag auch mehr als üblich von diesen doch auch sehr interessanten Pilzen vorstellen.
Phillip und Catrin (Text), Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich an unserem Parkplatz im Exkurionsgebiet begrüsste uns eine Birke mit vielen sterilen Knollen des Schiefen Schillerporlings (Inonotus obliquus). Es handelt sich um eine Pilzart aus der Familie der Borstenscheiblingsverwandten (Hymenochaetaceae). Er ist unter dem Namen Chaga (oder Tschaga) als volksmedizinisches Mittel gegen Krebs bekannt. Hier sehen wir Phillip, der aufgrund seiner Größe dazu verdonnert wurde, den „Chaga“ mit einem Stock für die interessierten Abnehmer zu entfernen. Foto: Angeli Jänichen

Es handelt sich hierbei um die Nebenfruchtform (Anamorphe) des Schiefen Schillerporlings, der sich als schwarzbraune knollige, oft bröckelig und wie verbrannt wirkende zerklüftete Struktur von meist unregelmäßig, kreisförmiger Ausdehnung zeigt. Schneidet man in die harte schwarze äußere Kruste hinein, zeigt sich das gelb-bräunliche Innere. Das Innere verfügt über eine korkartige Konsistenz und erscheint wie marmoriert. Namensgebend für den „Schiefen“ Schillerporling ist die sehr selten zu findende Hauptfruchtform (Teleomorphe) mit einer „schräg“ (schief) stehenden Porenschicht. Foto: Angeli Jänichen

Wir begannen unsere Exkursion dann in einem sumpfigen Bereich mit viel Totholzanteil. Hier sehen wir Angeli und Sylvina, die versuchen, trockenen Fußes durch den Sumpf zu kommen. Foto: Christopher Engelhardt

Hier fanden wir dann ein anderes Exemplar der Borstenscheiblingsverwandten (Hymenochaetaceae) an Erle – den sogenannten Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata). Die Röhrenschicht der Schillerporlinge erzeugt bei frischen Fruchtkörpern von schräg seitwärts betrachtet, je nach Lichteinfall, einen wechselnden (schillernden) Silberschein über gelbbraunem Grund – daher der Name „Schillerporling“. Foto: Christopher Engelhardt

Wir sehen hier wir ein schönes Exemplar des Reibeisen-Rindenpilzes (Xylodon radula). Er beginnt seine Entwicklung als kleine weißliche Flecken auf der Rinde abgestorbener Laubhölzer, meist an stehenden Stämmen oder noch am Baum befindlichen Ästen. In deren Mitte bilden sich die creme- bis ockerfarbenen Zähnchen, die deutlich gegenüber den hell bleibenden Rändern kontrastieren. Foto: Christopher Engelhardt

Und hier ein Vertreter der sogenannten „Spaltlippen“, die ihren Namen durch ihr äußeres Erscheinungsbild erhalten haben. Es handelt sich um den Spaltkohlenpilz (Hysterium angustatum) an der Rinde von Schwarzpappel. Foto: Angeli Jänichen

Hier sehen wir den „Graphischen Spaltkohlenpilz“ (Glonium graphicum) auf einem Kiefernstubben, den uns Torsten Richter bestimmt hat. Foto: Torsten Richter

Spaltlippen gibt es aber nicht nur auf Ästen oder Zweigen. Hier sehen wir die Kiefernnadelspaltlippe (Lophodermium pinastri), die auf paarweise angeordneten Kiefernnadeln am Erdboden als Folgezersetzer vorkommt. Erkennbar an den quergestreiften feinen Dermarkationslinien.

Ebenfalls auf Kiefernnadeln finden wir die Kiefernschütte-Spaltlippe (Lophodermium seditiosum). Hierbei handelt es sich allerdings um einen Schadpilz (Phytoparasit) als Auslöser der sogenannten Kiefernschütte. Die Nadeln werden dabei büschelweise „geschüttet“, wo sich ab Herbst dann auf dem Erdboden die spaltlippenförmigen Fruchtkörper bilden. Foto: Christian Boss
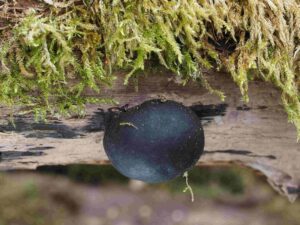
An Grauerle fanden wir dann Holzkohle-Kugelpilze (Daldinia concentrica agg.). Im Tarnewitzer Urwald nichts Ungewöhnliches – hier jedoch laut Torsten Richter, der das Gebiet wie seine Westentasche kennt und kartiert hat, ein Erstnachweis. Foto: Angeli Jänichen

Kohlenkugelpilze gibt es aber auch in kleiner Form. Das hier ist der Gesäte Kohlenkugelpilz (Ruzenia spermoides) auf einem Eschenstamm. Foto: Torsten Richter

Auch auf den Kohlenbeeren gibt es Pilze. Hier sehen wir winzige Perithecien eines Pustelpilzes (Cosmospora arxii) auf Zimtbraunen Kohlenbeeren (Hypoxylon howeianum) an Haselnuss. Als Perithecien bezeichnet man birnen-, kugel- oder flaschenförmige Fruchtkörper bei Schlauchpilzen (Ascomyceten). Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Wir bleiben bei den Kleinpilzen – bringen aber mal etwas Farbe in´s Spiel. Phillip fand ein Madensporiges Knopfbecherchen (Orbilia xanthostigma) auf einer entrindeten Zitterpappel. Die Fruchtkörper der Gattung Orbilia sind kleine (meist zwischen 0,2 und 2 mm im Durchmesser), wachsartige Apothecien, die durchscheinend oder leicht bis auffällig pigmentiert sind (meist mit Gelb- bis Rottönen, selten purpurviolett oder olivschwarz). Apothecien sind offene, schüssel-, scheiben- oder becherförmige Fruchtkörper bei Schlauchpilzen. Foto und Bestimmung: Torsten Richter

Catrin kniet und prüft Flache Lackporlinge (Ganoderma applanatum), ob sie sich evt. noch als Malerpilz verwenden lassen. Die Bilder werden auf der Porenseite des Pilzes erschaffen, da sich diese Poren an Druckstellen dauerhaft braun verfärben. Allerdings waren diese Exemplare schon zu trocken und nicht mehr zum Bemalen geeignet. Foto: Angeli Jänichen

Ebenfalls knieend sehen wir hier Phillip. Ansonsten hätte er wahrscheinlich die nachfolgenden kleinen Vertreter der Schlauchpilze (Ascomyceten) nicht entdeckt. Foto: Angeli Jänichen

Dieser Pilz hat seinen Namen erst nach dem Mikroskopieren erhalten. Er wuchs zwischen Scharbockskraut und Anemonen, so dass insgesamt 3 Arten in Frage kamen. Es handelt sich hierbei um den Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa), dessen wichtigstes Merkmal unter dem Mikroskop 4 Kerne in den Sporen ist. Foto: Catrin Berseck

Und fast zum Schluss unserer Wanderung zeigten sich tatsächlich noch Speisepilze an einem Nadelholzstubben! Wir sehen hier von der Trockenheit gezeichnete Rauchblättrige Schwefelköpfe (Hypholoma capnoides). Ein wohlschmeckender Speisepilz – allerdings muss er sehr gut durchgegart werden. Der Pilz gehört zu den Blausäuren ausscheidenden Pilzen, womit er sich vor Schnecken schützt. Foto: Catrin Berseck

Unser obligatorisches Abschlussfoto an der Radegast. V.l.n.r.: Angeli, Catrin, Eiman, Christian, Phillip und Torsten. Auf dem Foto fehlen Chris, Sylvina und Dorit.
Die Artenliste aus dem Radegasttal südlich von Rehna im MTB 2233/14:
Birnen-Stäubling (Apioperdon pyroforme), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Ohrlöffel-Stacheling (Auriscalpium vulgare), Fadenfruchtschleimpilz (Badhamia utriculare), Orangefarbenes Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Pustelpilz auf Zimtbrauner Kohlenbeere (Cosmospora arxii), Zerfließende Gallerträne (Dacrymyces stillatus), Holzkohle-Kugelpilz (Daldinia concentrica agg.), Rindensprengendes Eckenscheibchen (Diatrypella verruciformis), Anemonenbecherling (Dumontinia tuberosa), Teerfleckendrüsling (Exidia pithya), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Pappelknospen-Becherchen (Gemmina gemmarum), „Graphischer Spaltkohlenpilz“ (Glonium graphicum), Wurzelschwamm (Hetreobasidion annosum s.l.), Rauchblättriger Schwefelkopf (Hypholoma capnoides), Zusammengedrängte Kohlenbeere (Hpoxylon cohaerens), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxlon fuscum), Zimtbraune Kohlenbeere (Hypoxylon howeianum), Spaltkohlenpilz (Hysterium angustatum), Schiefer Schillerporling (Inonotus obliquus), Vielgestaltige Holzkohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Winterstiel-Porling (Lentinus brumalis), ohne deutschen Trivialnamen (Lentomitella cirrhosa), Zugespitzter Kugelpilz (Leptosphaeria acuta), Kiefernnadel-Spaltlippe (Lophodermium pinastri), Kiefernschütte-Spaltlippe (Lophodermium seditiosum), Madensporiges Knopfbecherchen (Orbilia xanthostigma), Herber Zwergknäueling (Panellus stipticus), Fleischroter Zystidenrindenpilz (Peniophora incarnata), Rostbrauner Feuerschwamm (Phellinus ferruginosus), Krauser Adernzähling (Plicatura crispa), Ampferblatt-Rostpilz (Ramularia rubella), Gesäter Kohlenkugelpilz (Ruzenia spermoides), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Samtiger Schichtpilz (Stereum submentosom), Bitterer Kiefern-Zapfenrübling (Strobilurus tenacellus), Ockertramete (Trametes ochracea), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Scharbockskraut-Rost (Uromyces poae), Erlen-Schillerporling (Xanthoporia radiata), Buchenfruchtschalenholzkeule (Xylaria carpophila), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon), Reibeisen-Rindenpilz (Xylodon radula)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
05.04.2025 – Öffentliche Pilzlehrwanderung
Öffentliche Pilzwanderung
Pilzwandern im Jahr der Amethystfarbenen Wiesenkoralle
Durch den Tarnewitzer Urwald bei Boltenhagen
Der Tarnewitzer Urwald ist dabei eines der Gebiete, das Reinhold öfter und sehr gerne aufgesucht hat – hier gibt es feuchte Erlen- und Eschenbrüche mit viel Totholz, aber auch ältere Buchen, Eichen und einige Nadelholzanteile. Diese abwechslungsreiche Habitatstruktur bietet also beste Voraussetzungen für eine große Pilz-Vielfalt. Und wir sollten nicht enttäuscht werden.
Es war kühles, aber strahlend sonniges Frühlingswetter. Aus den Bäumen singen Zaunkönig, Buchfink und Kleiber, es blühen Scharbockskraut, Geflecktes Lungenkraut und Hohe Schlüsselblume, auch frühe Insekten wie Tagpfauenauge und Großer Wollschweber sind bereits unterwegs.
Trotz der seit Wochen herrschenden Trockenheit, die eigentlich kaum Pilze erwarten ließ, konnten wir am Ende an die 35 verschiedene Pilz-Arten notieren. Überwiegend freilich an Holz wachsende und mehrjährige Arten, aber mit dem Frühlingsmürbling – Psathyrella spadiceogrisea ist auch ein echter Frischpilz mit Hut und Stiel dabei. An bekannter Stelle finden wir den Kupferroten Lackporling – Ganoderma pfeifferi wieder. Ein kleiner stummelfüßchenartiger Pilz, allerdings mit filzigem exzentrischen Stiel, lies sich erst später nach weiterer Recherche als Kegelstieliger Olivschnitzling – Simocybe haustellaris ansprechen. Und natürlich fanden wir sehr zahlreich die an sich seltenen Kohlen-Kugelpilze – Daldinia concentrica agg., für deren starkes Vorkommen unser Waldgebiet bekannt ist.
Am Ende sind zweieinhalb Stunden Exkursion wie im Flug vergangen. Es hat allen viel Spaß gemacht, wir haben eine Menge gefunden, einiges dazugelernt. Und fest steht: Fortsetzung folgt!
Chris (Text) und Catrin (Fotoauswahl und -beschriftung, Artenliste)

Gleich zu Beginn der Wanderung begrüßten uns diese Rotrandigen Baumschwämme – Fomitopsis pinicola an einer Birke. Bei diesen Exemplaren ist der namensgebende rote Rand wunderschön ausgeprägt. Foto: Christopher Engelhardt

Frühlingserwachen in den feuchten Erlen- und Eschenbrüchen – Hohe Schlüsselblume – Primula elatior. Foto: Catrin Berseck

Auch die Insektenwelt ist erwacht. Da Chris sich nicht nur für Pilze interessiert, konnten wir auch von seinem umfangreichen Wissen über Insekten und Pflanzen profitieren. Hier der Große Wollschweber – Bombylius major auf Scharbockskraut – Ficaria verna. Foto: Christopher Engelhardt

Zu Beginn unserer Wanderung drehte Hanjo ein finalverrottetes Holzstück auf dem feuchten Boden um. Auf der Unterseite fanden wir viele verschiedene holzzersetzende Pilze. Hier nicht näher bestimmte Weichbecherchen aus der Gattung Mollisia. Foto: Christian Boss

Auch diesen kleinen Pilz mit seinem filzigen stummelfüßchenartigen Stiel fanden wir unter dem Holzstück. Er erfreute uns besonders – stellte sich doch im Nachgang heraus, dass es sich um den seltenen Kegelstieligen Olivschnitzling – Simocybe haustellaris handelt. Foto: Christian Boss

Weiter ging es durch den Urwald. Hier Birnen-Stäublinge – Apioperdon pyriforme aus dem Vorjahr an einem bemoosten Baumstubben. Schön zu sehen die Öffnung in der äußeren Schicht (Peridie) am oberen Ende der Fruchtkörper, durch die die Sporen als brauner Staub entlassen werden. Foto: Christopher Engelhardt

Endlich begegneten wir einem Frischpilz! Die eiförmige und geriefte Huthaut des Gemeinen Glimmertintlings – Coprinus micaceus cf ist mit glimmrig glitzernden Schüppchen (Velumreste) besetzt, die krümelig aufreißen. Bei Regen werden sie allerdings schnell abgespült. Foto: Catrin Berseck

Und in unmittelbarer Nähe fand Hanjo dann auch noch den Frühlingsmürbling – Psathyrella spadiceogrisea. Dieser häufige Frühlingspilz wächst saprophytisch an abgefallenen Ästen oder in der Nähe alter Stubben, aber auch auf dem Erdboden in feuchten Laubwäldern von März – Mai. Er ist essbar, meist aber wenig ergiebig. Foto: Catrin Berseck

Der Frühlingsmürbling wird auch Schmalblättriger Faserling genannt. Die Lamellen sind schmal, erst hell beige, bei der Sporenreife schwarzbraun, mit weißen Schneiden. Ein häufiger Frühjahrspilz und Anzeiger, dass es bald Morcheln geben könnte. Foto: Christopher Engelhardt

Auf unserem weiteren Weg zum befestigten Wegrand begegneten wir immer wieder den ansonsten sehr seltenen Kohlen-Kugelpilzen – Daldinia concentrica agg.. Foto: Christopher Engelhardt

Der ansonsten eher selten zu findende Kohle-Kugelpilz ist im Tarnewitzer Urwald sehr stark vertreten – man kann schon fast von einem Massenvorkommen sprechen. Foto: Catrin Berseck

Und dann entdeckte Hanjo am Wegrand an einem toten Buchenstamm tatsächlich noch frische Austernseitlinge – Pleurotus ostreatus. Ein ausgezeichneter und beliebter Speisepilz, der sich durch seine muschelförmige Form und seinen fleischigen Geschmack auszeichnet. Er wird oft auch als Kalbfleischpilz bezeichnet. Foto: Hanjo Herbort

Weiter ging es zu dem uns bekannten Standort des Kupferroten Lackporlings – Ganoderma pfeifferi am Fuße einer alten Rotbuche. Ein sehr seltener Baumbewohner, den wir immer gerne besuchen. Foto Christopher Engelhardt

Und am Ende unserer sehr schönen Wanderung fanden wir dann noch diesen an einem toten Buchenstamm hinterlassenen „Pilzgruß“. Wer weiß, wer uns diesen Gruß hinterlassen hat… Foto: Catrin Berseck

Unser Erinnerungsfoto an eine schöne Frühlingswanderung durch den Tarnewitzer Urwald. V.l.n.r.: Dorit, Hanjo, Jürgen, Catrin, Eiman, Christian und Chris. Foto: Christopher Engelhardt
Die Artenliste aus dem Tarnewitzer Urwald im MTB 2033/14:
Birnen-Stäubling (Apioperdon pyroforme), Buchen-Rindenschorf (Ascodichaena rugosa), Judasohr (Auricularia auricula-judae), Tintenstrichpilz (Bispore antennata), Orangefarbenes Brennnesselbecherchen (Calloria neglecta), Glimmer-Tintling (Coprinellus micaceus cf.); Holzkohle-Kugelpilz (Daldinia concentrica agg.), Zunderschwamm (Fomes fomentarius), Rotrandiger Baumschwamm (Fomitopsis pinicola), Flacher Lackporling (Ganoderma applanatum), Kupferroter Lackporling (Ganoderma pfeifferi), Rotbraune Borstenscheibe (Hymenochaete rubiginosa), Rotbraune Kohlenbeere (Hypoxlon fuscum), Schwarzbrauner Holzkohlenpilz (Hypoxylon petriniae), Vielgestaltige Holkohlenbeere (Jackrogersella multiformis), Brandkrustenpilz (Kretzschmaria deusta), Zugespitzter Kugelpilz (Leptosphaeria acuta), Herber Zwergknäueling (Panellus stipticus), Austernseitling (Pleurotus ostreatus), Löwengelber Schwarzstielporling (Polyporus varius), Früher Mürbling (Psathyrella spadiceogrisea), Ahorn-Runzelschorf (Rhytisma acerinum), Gemeiner Spaltblättling (Schizophyllum commune), Kegelstieliger Olivschnitzling (Simocybe haustellaris), Striegeliger Schichtpilz (Stereum hirsutum), Rötender Runzel-Schichtpilz (Stereum rugosum), Buckel-Tramete (Trametes gibbosa), Ockertramete (Trametes ochracea), Schmetterlingstramete (Trametes versicolor), Rotköpfiger Schleimpilz (Trichia decipiens), Buchenfruchtschalenholzkeule (Xylaria carpophila), Geweihförmige Holzkeule (Xylaria hypoxylon), Langstielige Ahorn-Holzkeule (Xylaria longpipes)
Wann startet die nächste Lehrwanderung? – Siehe unter Termine!
Januar bis März
Neujahrstreffen der Pilzfreunde
Dienstag, 28. Januar 2025, 18.00 Uhr im Mykologischen Informationszentrum Steinpilz – Wismar, in der ABC Straße 21.
Der erste Monat des neuen Jahres neigte sich bereits seinem Ende zu. Höchste Zeit für das „Neujahrstreffen“ der Pilzfreundinnen und Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e. V. In gemütlicher Runde haben wir das neue Pilzjahr 2025 begrüßt.
In der Hoffnung auf reichlich Pilzfunde im neuen Jahr, aber auch in Sorge um unseren schwer erkrankten Pilzfreund Reinhold Krakow haben wir uns im „Steinpilz Wismar“ getroffen. Reinhold Krakow hatte uns die Räume zur Verfügung gestellt, konnte selbst aber krankheitsbedingt nicht teilnehmen. Wir ahnten noch nicht, dass es die letzte öffentliche Veranstaltung im Mykologischen Informationszentrum in der ABC-Straße sein würde.
Inhaltlich ging es um die Sterne, speziell das Sternbild Orion. Unser vielseitig interessierter und sachkundiger Pilz- und Naturfreund Christopher Engelhardt hatte einen interessanten Vortrag vorbereitet, den wir erlebten und dazu ins Gespräch kamen. Chris schreibt dazu: „Die ganze Natur, vom kleinsten Lebewesen bis zu unvorstellbar großen Galaxien lädt zum Entdecken und Staunen ein.“ Ausgehend vom Sternbild Orion erfuhren wir, dass zum Sternbild mehr als nur der weithin bekannte Gürtel des Orion gehört bzw. die Sterne, die ihn bilden. Es ging, darum, welche Sterne das Sternbild insgesamt bilden und wie sie in der Vergangenheit von den Menschen gedeutet wurden, welche Bedeutung ihnen beigemessen wurde und in welche Mythen und Erzählungen sie eingebettet waren und sind. Es ging aber auch darum, wie hell welcher Stern leuchtet und warum – auch über den Orion hinaus. Dass ein Stern uns heller erscheint, muss nicht daran liegen, dass er heller leuchtet, sondern kann auch damit zusammenhängen, dass er der Erde näher steht als andere Sterne. Auch Aspekte wie die Zusammensetzung der Sterne und ihr Alter spielen eine Rolle. Dass alles und die vertraute Atmosphäre des Zusammenstehens für einander entließen uns hoffnungsvoll ins beginnende Jahr 2025.
Dirk

Die Pilzfreundinnen und Freunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e. V. zum letzten Neujahrstreffen im Steinpilz – Wismar, ABC-Straße 21. Foto: Hans-Peter Firniß
Steinpilz – Wismar
Nachruf Reinhold Krakow
 Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Freund Reinhold Krakow, der am 01. Februar 2025 den Kampf gegen seine Krankheit verlor. Reinhold war seit vielen Jahren der stolze Inhaber des einzigartigen Ladens „Der Steinpilz“ Wismar. Dieser Laden, den er mit Leidenschaft und Hingabe führte, wurde zu einem lebendigen Treffpunkt für Pilzfreunde und Naturinteressierte und zu einem echten Herzstück der Region Wismar.
Mit tiefem Bedauern nehmen wir Abschied von unserem Freund Reinhold Krakow, der am 01. Februar 2025 den Kampf gegen seine Krankheit verlor. Reinhold war seit vielen Jahren der stolze Inhaber des einzigartigen Ladens „Der Steinpilz“ Wismar. Dieser Laden, den er mit Leidenschaft und Hingabe führte, wurde zu einem lebendigen Treffpunkt für Pilzfreunde und Naturinteressierte und zu einem echten Herzstück der Region Wismar.
Reinhold sah in dem „Steinpilz“ Wismar weit mehr als nur ein Geschäft – er schuf einen Ort, an dem Wissen, Austausch und die Freude an der Natur im Mittelpunkt standen.
Neben seiner Arbeit im Laden widmete sich Reinhold mit genauso viel Engagement dieser Website, auf der er über Jahre hinweg eine Vielzahl an Informationen rund um Pilze, ihre Bestimmung und die richtige Handhabung bereitstellte. Diese Website wurde zu einer unverzichtbaren Anlaufstelle für viele Pilzsammler und Naturfreunde, die seine Expertise und seine Liebe zur Natur zu schätzen wussten.
Reinhold war ein wahres Urgestein der heimischen Pilzkunde. Mit seinem umfassenden Wissen, seiner Erfahrung und seiner Begeisterung für die Welt der Pilze hat er Generationen von Pilzfreunden inspiriert und begleitet. Sein Rat war geschätzt, seine Leidenschaft ansteckend.
Reinhold Krakow hinterlässt ein bleibendes Lebenswerk – sowohl in den vielen Menschen, die durch seinen Laden und seine Website bereichert wurden, als auch in der Pilzgemeinschaft, die er mit seinem Wissen und seiner Hingabe geprägt hat. Er war nicht nur ein Fachmann, sondern auch ein Mensch, der mit seinem einzigartigen Charakter vielen Menschen in Erinnerung bleibt.
Wir fühlen uns geehrt, seine Website weiterführen zu dürfen und sein Vermächtnis mit Leben zu füllen. In seinem Sinne werden wir weiterhin Pilzwanderungen sowie weitere Veranstaltungen wie Seminare und Exkursionen anbieten, um sein Wissen und seine Begeisterung an künftige Generationen weiterzugeben.
Reinhold, du wirst in unseren Herzen weiterleben – als ein Vorbild für Hingabe, Wissen und Leidenschaft.
Ruhe in Frieden, lieber Freund.
Phillip
Abschied im Wald
 Am Montag, den 24. Februar 2025 haben wir im RuheForst Schweriner Seen von Reinhold Krakow Abschied genommen. Etwa 80 Angehörige, Freunde und Bekannte waren zur Urnenbeisetzung gekommen. Einige hatten eine weite Anreise auf sich genommen: aus Hamburg, Berlin oder Leipzig.
Am Montag, den 24. Februar 2025 haben wir im RuheForst Schweriner Seen von Reinhold Krakow Abschied genommen. Etwa 80 Angehörige, Freunde und Bekannte waren zur Urnenbeisetzung gekommen. Einige hatten eine weite Anreise auf sich genommen: aus Hamburg, Berlin oder Leipzig.
Sie alle fühlten sich in besonderer Weise mit Reinhold verbunden, oft weit über die Pilzkunde hinaus. Reinhold hatte mit unzähligen Pilzwanderungen, Dutzenden von mehrtägigen Pilzseminaren und vielen anderen Veranstaltungen über Jahrzehnte hinweg Generationen von Teilnehmern und Interessenten für die Pilzwelt begeistert und mit großer Kompetenz und Geduld immer wieder Pilzwissen vermittelt.
Das kam in dieser Abschiedsfeier sehr bewegend zum Ausdruck.

Beim anschließenden, von Irena liebevoll und reichlich zubereiteten Büfett im Wald konnte nicht nur ich viele Freunde und Weggefährten begrüßen, und Menschen, die sich zum Teil viele Jahre lang nicht gesehen hatten, führten intensive Gespräche, konnten Erinnerungen und Erfahrungen austauschen.
Erst nach fünf Stunden machten sich die Trauergäste nach und nach auf den Heimweg – es war ein würdiger, trauriger, aber vor allem auch dankbarer Abschied in der denkbar passendsten Umgebung. Reinholds Urne liegt nun unter einem Baum im RuheForst, nahe zwei feuchten Senken, einem idealen Pilzgebiet. Und wie zum Abschied sangen Kleiber, Kohlmeise und Grünspecht aus den Zweigen ihre Lieder.
Chris
Wie geht es weiter?
Viele Leser werden sich fragen, wie es mit der Internetseite „Steinpilz-Wismar“, dem Tagebuch, Veranstaltungen und dem Laden in Wismar nach dem Tod von Reinhold Krakow weiter geht …
Einer der letzten Wünsche von Reinhold war es, dass diese Internetseite, die sozusagen sein Lebenswerk war und mit vielen und wertvollen Informationen rund um die Pilze gefüllt ist, weitergeführt wird. Genauso hat er sich gewünscht, dass wir Wanderungen, Mittwochs- bzw. Kartierungsexkursionen und andere Veranstaltungen in Zukunft anbieten.
„Wir“ – das sind die Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V.. Der Verein hat Reinhold von Anfang an unterstützt und wird es auch jetzt weiterhin tun.
„Wir“ sind mehrere Pilzsachverständige der DGfM, die ihr Wissen hauptsächlich durch Reinhold erworben haben und dadurch erst die Prüfung ablegen konnten. Des weiteren sind noch viele sehr Pilzinteressierte dabei, von denen einige evtl.. demnächst die Prüfung ablegen werden.
„Wir“ sind alle daran interessiert, dass diese Website erhalten bleibt und weitergeführt wird und möchten gerne unser Wissen auch weiterhin anderen Pilzinteressierten im „www“ zur Verfügung stellen.
Wie ihr sicherlich schon gesehen habt, haben wir die Internetseite etwas umsortiert und die vielen einzelnen Beiträge von Reinhold in Kategorien einsortiert, damit es etwas übersichtlicher wird. Einige Termine haben wir bereits online gestellt – weitere folgen in Kürze.
Wir werden in Zukunft weiterhin von Pilzfunden und Exkursionen berichten. Wir werden das nicht in dem Umfang leisten können, wie Reinhold das gemacht hat – aber in regelmäßigen Abständen werdet ihr Beiträge in „Pilze und Wetter 2025“ finden. Diese Beiträge werden von verschiedenen Mitgliedern des Vereins geschrieben werden. Allerdings wird Reinholds weiteres Steckenpferd „Das Wetter“ dabei etwas auf der Strecke bleiben müssen …
Wir würden uns auch freuen, wenn ihr als fleißige Leser der Internetseite und des Tagebuchs uns mit schönen Fotos oder eigenen Beiträgen unterstützen würdet. Gerne könnt ihr das per E-Mail an info@gemeinnuetzige-wismar.de schicken.
Den Laden in Wismar in der ABC-Str. 21 hat Reinhold privat betrieben. Diese stationäre Pilzberatungsstelle kann leider nicht weitergeführt werden und wird deshalb aufgelöst.
„Wir“ hoffen, dass ihr uns als treue Leser und Unterstützer der Website erhalten bleibt und wir euch von den Pilzen auch weiterhin begeistern können.
Catrin von und im Auftrag der Pilzfreunde der Gemeinnützigen Gesellschaft Wismar e.V.